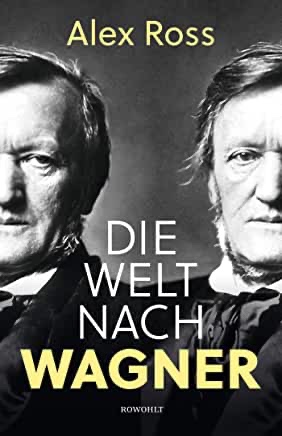Alex Ross, Die Welt nach Wagner – Ein deutscher Künstler und sein Einfluss auf die Moderne (Originaltitel: Wagnerism). Aus dem Englischen von Gloria Buschor und Günter Kotzor. Rowohlt, Hamburg 2020, 907 S., 15 farbige und zahlreiche s-w Abb., € 40,90, ISBN: 978-3-498-00185-8
„Wagnerism“ ist kein Buch für das Nachtkastl, das man so wegschmökert wie einen guten Roman. Es ist ein Buch für Wagnerianer und Nicht-Wagnerianer mit dem wissenschaftlichen Anspruch, dem hassgeliebten Idol differenziert zu begegnen und eigene Positionen einmal aufs Neue in Frage zu stellen.
von Dr. Andreas Ströbl
Das Outing als Wagnerianer fühlt sich in mancher Gesprächsrunde so an, als hätte man soeben verkündet, dass man seit Jahren drogenabhängig ist, aber die Sache im Griff hat. Wenn man nicht gerade auf dem Grünen Hügel unter den anderen Junkies steht, beschleicht den kritischen Liebhaber der Wagner’schen Musik mitunter das Gefühl, sich für irgendetwas rechtfertigen zu müssen.
Kaum ein Komponist und sein Werk werden so sehr von der Rezeption dominiert, wie das bei Richard Wagner der Fall ist. Auch gibt es kaum eine Künstlerpersönlichkeit, die so gegensätzliche und heftige Reaktionen auslöst. Der Begriff der Polarisierung wirkt dabei schon reichlich abgedroschen, ist hier aber angebracht. Denn nur wenige schaffen das, was Wagner wirken kann: eine Spaltung der Einstellung zu ihm innerhalb des einzelnen Rezipienten.
Alex Ross‘ Buch über die Wagner-Rezeption außerhalb der Musik ist seit dem Erscheinen lebhaft rezensiert worden, unter anderem detailliert und kenntnisreich von Jolanta Łada-Zielke in diesem Blog. Daher sei erlaubt, an dieser Stelle einige ausgewählte Aspekte auszuleuchten und persönliche Reflektionen einzuflechten.
Ich persönlich empfinde für niemanden so starkes Fremdschämen wie für Wagner, so sehr ich seine Musik liebe. Wie sein Antisemitismus nun exakt zu klassifizieren sei und welche Wege von Wahnfried in die Reichskanzlei geführt haben mögen, ist intensiv und vor allem diskursiv erörtert worden. Moshe Zuckermann hat wenige Monate vor dem Erscheinen von Ross‘ „Die Welt nach Wagner“ mit seiner Publikation „Wagner – Ein ewig deutsches Ärgernis“ (Frankfurt/Main 2020) eine weitere wichtige Wegmarke zu dieser Diskussion gesetzt. Sein Fazit, dass es hinreichend Gründe gibt, sich von Wagner abgestoßen zu fühlen, er aber leider auch ein Genie war, trifft es prägnant.
Die linke Wagner-Szene versucht spätestens seit George Bernhard Shaw immer wieder und durchaus mit heißem Bemühn, „ihren“ Wagner aus der braunen Brühe zu retten, zu der schon Cosima und Winifred die Mehlschwitze haben anbrennen lassen. Wagner selbst gibt mit seinen widersprüchlichen Bemerkungen und Relativierungen dazu reichlich Stoff, aber man möchte ihn doch immer wieder gerne an der Hand nehmen und mit ihm wie mit einem auf den allzu rechten Weg gekommenen Jugendlichen durch Auschwitz gehen und ihn an seine widerwärtigen Auslassungen erinnern. Da kann man gleich Luther mitnehmen, denn vom Juden-Verbrennen phantasierten ja beide.
Die Droge Wagner ist eine legale und wird dem unschuldigen Kinde schon von den eigenen Eltern verabreicht. Mitunter wird sie einem unerkannt ins Fläschchen geschüttet. Als Kinder haben wir James Krüss‘ „Sängerkrieg der Heidehasen“ von 1958 geliebt und Jahre später erst realisiert, dass der Hase Lodengrün und die quäkige Tannhäuser-Fanfare auf der Festwiese liebenswerte Anleihen aus Wagners Werk waren. Die Wagner-Anspielungen in den Bühnenstücken von Curt Goetz und deren Verfilmungen sind ebenso harmlos wie die Fernsehserie „Der Doktor und das liebe Vieh“ aus den späten 70er- und den 80er-Jahren mit den Landärzten Siegfried und Tristan Farnon und all den Musik-Zitaten.
Diese Beispiele tauchen bei Alex Ross zwar nicht auf, aber sein gut 900 Seiten starkes Opus ist randvoll mit Belegen, wie untrennbar erstaunlich große Teile der Literatur und Kunst des 20. Jahrhunderts sich aus Wagners Schaffen speisen wie aus einem nicht versiegenden Gral. Ihm ist gerade diese Fülle an Informationen und Beispielen, zwischen denen er mitunter hin- und herassoziiert, in einigen Rezensionen vorgeworfen worden. Weniger wäre hier sicher nicht mehr gewesen, sondern schlicht zu kurz gegriffen – der Themenkomplex hat es nun mal in sich.
Gerade der Aufbau des Buches ist stringent und die charmante, leitmotivhafte Benennung der Kapitel mehr als nur eine Art, solch einen Brocken zu gliedern. Mit des „Meisters“ Tod im Palazzo Vendramin wurden seine bestürzten Jünger zu seinen Priestern und die Verehrung geriet zum Kult. Von diesem Vorspiel schreitet Ross durch die folgenden knapp 130 Jahre mit all den ekstatischen Zuckungen, wie Wagner es selbst genannt hätte, über den schlimmsten aber so leichtgemachten Missbrauch bis zu den jüngsten filmischen Adaptionen. Die Wunde bleibt und kein Speer schließt sie. Das erste und letzte Wort lässt er den naiv-weisen Rheintöchtern, die die Falschheit und Feigheit der Herrschenden beklagen.
Allein, es folgt ein Nachwort, in dem Ross ohne Schonung seiner selbst seine ganz persönliche Drogengeschichte mit den, wie Nietzsche es fasste, „opiatischen und narkotischen Wirkungen“ dieser Musik erzählt.
„Wagnerism“ ist kein Buch für das Nachtkastl, das man so wegschmökert wie einen guten Roman. Es ist ein Buch für Wagnerianer und Nicht-Wagnerianer mit dem wissenschaftlichen Anspruch, dem hassgeliebten Idol differenziert zu begegnen und eigene Positionen einmal aufs Neue in Frage zu stellen.
In einem Gespräch mit dem Lübecker GMD und Operndirektor Stefan Vladar ertappte ich mich neulich wieder bei einem dieser Versuche, Wagner vor sich selbst zu retten und stieß auf deutliche, dankenswerte Gegenwehr. Können wir denn tatsächlich so sicher sein, dass das revolutionäre Herz von 1848 auch noch 17 Jahre später schlug, als der bankrotte und verzweifelte Wagner Aufnahme bei Ludwig II. gefunden hatte und begann, seine Memoiren zu verfassen? Das ist wieder einer dieser Brüche in Wagners Leben und seinen Selbstzeugnissen: Seine Briefe an den jungen König triefen dermaßen von Servilität und kriecherischer Anbiederung, dass man sie am liebsten tief in Niflheims Kellern verstecken möchte. Wobei der, um es euphemistisch auszudrücken, schwärmerische Ton in der Korrespondenz beiden zu eigen war. Ross bringt es auf den Punkt, wenn er diese Beziehung auf eine gegenseitige Abhängigkeit herunterbricht: Der eine braucht die Musik, der andere das Geld.
Zugleich hält Wagner die alten Ideale hoch und schreibt in „Mein Leben“: „Auf die Proudhonschen und anderer Sozialisten Lehren von der Vernichtung der Macht des Kapitales durch die unmittelbar produktive Arbeit baute er [der Dirigent, Komponist und Revolutionär August Röckel, ein enger Freund des Anarchisten Michail Bakunin, mit dem auch Wagner in Beziehung gestanden hatte] eine ganz neue moralische Weltordnung auf, für welche er mich allmählich durch einige sehr anziehende Behauptungen darüber selbst insoweit gewann, dass ich nun wieder meinerseits darauf die Realisierung meines Kunstideals aufzubauen begann“.
Der Politologe und Wagner-Spezialist Udo Bermbach hat 1994 in seinem Buch „Der Wahn des Gesamtkunstwerks – Richard Wagners politisch-ästhetische Utopie“ das Festhalten an der „sozialistisch-anarchistische[n] Position als Grundlage des Wagnerschen »Kunstideals«“ (Bermbach 1994, S. 61) deutlich hervorgehoben. Sogar Cosima zitiert ihren Gatten in ihren Tagebüchern im Jahre 1881: „er kommt auf den Besitz zu sprechen, den er als Grund-Übel von allem erkennt.“
Wie aufrichtig Wagner, der bekanntlich nichts dagegen hatte, unter anderem eine repräsentative Villa zu besitzen, hier zu sich selbst, zu Cosima und seinen Lesern war, bleibt spekulativ, aber auch hier lohnt ein Blick auf die Rezeption bzw. eine Parallele, die aufgrund der scheinbaren Unvereinbarkeit der beiden Köpfe jahrzehntelang kaum oder nur von wenigen beachtet, wenn nicht völlig geleugnet wurde. Es geht um frappante Ähnlichkeiten zweier Künstler, die sich als Reformer sahen und die, wie Joy Calico in „Brecht at the Opera“ (Oakland 2019) geistreich bemerkt, „durch den Strom, der zwischen ihnen fließt, verbunden“ (nach Ross 2020, S. 541) sind: Wagner und Bertolt Brecht.
Bereits Martin Gregor-Dellin hat in „Richard Wagner – Sein Leben, sein Werk, sein Jahrhundert“ (München 1989) auf Parallelen in Anspruch und Umsetzung hingewiesen, denn Wagner und Brecht verbindet die Vorstellung von der eigenen medialen Vermittlung eines hohen Zieles und der Ehrgeiz, die empfangende Gesellschaft ästhetisch zu erziehen. Wagner nennt das „Vollendete Darstellung durch Gründung eines eigenen neuen Stiles“ und hier sieht Gregor-Dellin die direkte Vorwegnahme eines Grundpfeilers von Brechts „Epischem Theater“, das Wieland Wagner in seiner Regie wesentlich beeinflussen sollte. In einem Gespräch mit der ZEIT und Udo Bermbach von 2013 bläst Peter Konwitschny in das gleiche Horn, und es ist ein ausgesprochenes Verdienst von Alex Ross, dass er diese und weitere Gesichtspunkte mehrfach anspricht. Orthodoxe Brechtianer und konservative Wagnerianer sind gut beraten, ihre Vorstellungen vom jeweiligen Idol zu relativieren, wenn nicht grundsätzlich in Frage zu stellen.
In einem Gespräch mit Christoph Schlingensief über diese Thematik sprang er sofort begeistert darauf an und meinte, man müsse „unbedingt was daraus machen“. Der Tod dessen, der sich damals augenzwinkernd als „Reinkarnation von Richard Wagner“ bezeichnete, setzte bald darauf jedem weiteren Austausch und allen möglichen Projekten ein Ende.
Ross attestiert übrigens sowohl Brecht als auch Schlingensief die Übernahme der Wagnerschen Idee vom Gesamtkunstwerk, die aus dem Wahn zum real existierenden, wirkmächtigen Topos wuchs.
Entgegen weitverbreiteter Meinung stammt der Terminus des Gesamtkunstwerks tatsächlich nicht von Wagner, sondern ist ein Kind der deutschen Romantik. Der Schriftsteller und Philosoph Eusebius Trahndorff prägte ihn 1827 in seiner programmatischen Schrift „Ästhetik oder Lehre von der Weltanschauung und Kunst“. Damit badet man zusammen mit den Rheintöchtern in der romantischen Idealvorstellung eines von den Kräften des Kapitalismus noch verschonten natürlichen Urzustandes. Der wird beispielsweise im 2005 erschienenen Film „The New World“ von Terrence Malick beschworen, in dessen Beginn zum wundervollen Es-Dur-Vorspiel des „Rheingolds“ drei nackte Indianermädchen im klaren Wasser schwimmen, das kurz darauf vom Schiffskiel der europäischen Siedler durchschnitten wird.
Ross verweist in diesem Zusammenhang auf Wagners Aufsatz „Kunst und Klima“ von 1850, in dem er an die Menschheit appelliert, sich künftig der „ganzen Erdnatur“ sorgend zuzuwenden. Im gleichen Jahr erschien „Das Judenthum in der Musik“. Wäre der „Meister“ mal bei der Kritik an der Industrialisierung geblieben, mit den unmenschlichen Maschinenhämmern im „Rheingold“ und hätte er seine geplante Buddha-Oper „Die Sieger“ mit der zentralen Tugend des Mitleids geschrieben – die Welt nach Wagner sähe anders aus.
Wie bei allen Drogen gilt auch hier: Vernünftiger Umgang muss den Genuss nicht schmälern und Vernunft bedeutet auch, sich historisch-kritisch, jenseits von Liebe und Hass, mit Werk und Wirkung auseinanderzusetzen. Daher sollte Ross‘ Buch in keiner Bibliothek eines Wagnerianers fehlen.
Und was können wir lernen aus der Geschichte seit dem Tod in Venedig 1883? Der Fall Wagner kann Kulturschaffenden bewusst machen, welch große Verantwortung sie als Sprachrohre, Wertvermittler und Pädagogen haben, deren Stimmen gehört und mitunter kritiklos aufgenommen werden. Das Dritte Reich stand auf einem Sockel aus Verschwörungstheorien und esoterischem Geschwurbel, den Reichsparteitag untermalte das Vorspiel zu den „Meistersingern“.
Unbedachte Äußerungen von Künstlern und Intendanten können als reife Samen in Zeiten der Corona-Leugnung und einer erstarkten politischen Rechten auf eine wieder fruchtbare braune Krume fallen. Einmal tausend Jahre sind genug.
Dr. Andreas Ströbl, 4. Januar 2021, für
klassik-begeistert.de und klassik-begeistert.at