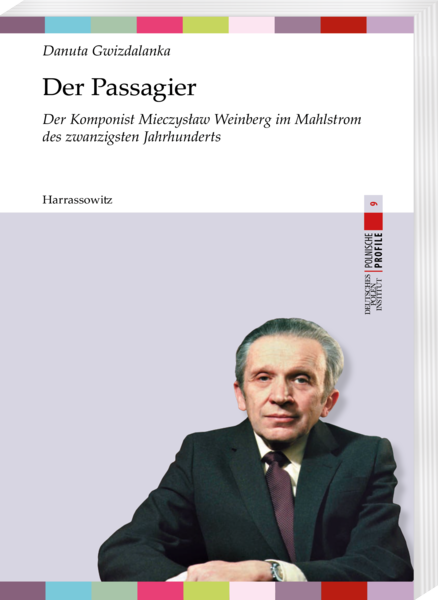Foto: Buchcover
Buchbesprechung
Danuta Gwizdalanka: „Der Passagier
Der Komponist Mieczysław Weinberg im Mahlstrom des zwanzigsten Jahrhunderts“
Harrassowitz Verlag, der Zyklus: Polnische Profile
Übersetzer: Bernd Karwen
ISBN 978-3-447-11409-7
von Jolanta Łada-Zielke
Ich habe bereits Mieczysław Weinbergs Biographie von David Fanning besprochen, die 2010 veröffentlicht wurde. Bei einigen Fakten bezieht er sich aber auf Danuta Gwizdalanka und sie sich auf ihn. Beide Bücher ergänzen und bereichern sich sogar gegenseitig. Die Version der polnischen Musikwissenschaftlerin ist insofern wertvoll, als Weinberg ein Bekannter ihres Mannes, des Komponisten Krzysztof Meyer, war und mit ihm einen Briefwechsel führte. Also kennt die Autorin einige Details aus erster Hand.
Die polnische Fassung der Biografie trägt den Titel Wajnberg – nach der polnischen Schreibweise, obwohl man seinen Namen seit Beginn seiner künstlerischen Tätigkeit nach der deutschen Schreibweise – „Weinberg“ – geschrieben hat. Er selbst sagte, dass sich sein Nachname aus „Wein“ (was auf Deutsch sowohl Wein als auch Weinen bedeutet) und „Berg“ zusammensetzt.
Nach der Lektüre von Gwizdalankas Buch kann ich besser verstehen, warum Weinbergs Schaffen im Westen einen größeren Erfolg hatte. Die Russen assoziierten ihn hauptsächlich mit Filmmusik, und die Polen erkannten ihn erst nach dem Erfolg der Passagierin als ihren Komponisten an. Heute kann man in seiner Heimatstad Warschau auf seinen Spuren wandeln. Ein Führer für diese Route ist auf der Website zu finden: Warszawawajnberga.pl.
Gwizdalanka behauptet, dass man heute seine Werke nach Chopin am zweithäufigsten aufführt. Früher mag er in Polen unbeliebt gewesen sein, weil er die Rote Armee als seinen Retter betrachtete, ohne die es seine Kunst nicht gegeben hätte. Als Kind hat man mir auch ein solches Bild der UdSSR dargestellt, die mit uns zusammen gegen den deutschen Nationalsozialismus kämpfte. Erst in den 1980er Jahren begannen meine Landsleute – zunächst inoffiziell – von den Sowjets als einer weiteren Besatzungsmacht zu sprechen. Die Biographie dieses Komponisten – so die Autorin – macht die Tatsache noch attraktiver, dass er als ein Opfer des Totalitarismus des 20. Jahrhunderts gilt, mit seiner dreifachen Identität: er war sowohl Jude als auch Pole, den das Schicksal in das Zentrum des sowjetischen Musiklebens geworfen hat.
Zum Beginn Gwizdalankas Erzählung bekommen wir ein nostalgisches Bild von Warschau zwischen zwei Weltkriegen, wo die Bevölkerung zu einem Drittel jüdisch war. Die polonisierten Juden bildeten die finanzielle und künstlerische Elite der Stadt. Moshe Weinberg änderte zwar seinen Namen in Mieczysław, aber die jüdischen Melodien und Rhythmen, die er noch als Kind lernte, blieben für immer in seinem Kopf. Als 12-Jähriger trat er ins Konservatorium ein. Während der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren jobbte er als Pianist, um seine Familie finanziell zu unterstützen.
Sehr detailliert und dramatisch ist die Beschreibung seiner Flucht in den Osten nach Ausbruch des Krieges. Weinbergs jüdische Herkunft half ihm, die Grenze der Belarussischen Sowjetrepublik zu überschreiten. Als er in den 1950er Jahren schon in der Sowjetunion lebte, wurde er aus dem gleichen Grund (als Jude) verfolgt.
Nach dem Kriegsende sagte Weinberg, dass der Frieden nun erkämpft werden müsse, und dass dies viel schwieriger sei. Er hatte recht. Solange Stalin lebte, fühlten sich die jüdischen Intellektuellen in der Sowjetunion unsicher. Man spürt die damalige ängstliche Atmosphäre beim Lesen. David Fanning erzählt ein bisschen mehr über Weinbergs Aufenthalt in Stalins Gefängnis und über die Umstände des Todes seines Schwiegervaters Solomon Michoels im Januar 1948. Ein Ersatz für die verlorene Heimat Weinbergs war für ihn die polnische Sprache, die er sorgsam pflegte.

Der totalitäre Staat unterstützte jedoch seine führenden gewerkschaftlich organisierten Komponisten und ermöglichte ihnen, ihre Kreativität ohne materielle Sorgen auszuleben: Vorausgesetzt natürlich, dass ihre Werke politisch korrekt waren. Obwohl sich die Musik dort in einer weitaus besseren Situation befand als die Literatur, hat die sowjetische Zensur auch hier die „dekadenten“ und „pro-westlichen“ Tendenzen ausgesucht und stigmatisiert.
Weinberg erfüllte die Anforderungen nicht immer, aber in den sechziger Jahren konnte er sich ungehindert auf das Komponieren konzentrieren. Er erhielt auch besser bezahlte Aufträge für Gebrauchsmusik, vor allem für Zirkus und Film. Jüdische und polnische Motive waren in seinem Werk jedoch stets präsent. Seine Kriegserfahrungen haben es ebenso beeinflusst.
Sowohl Gwizdalanka als auch Fanning betonen die Bedeutung von Weinbergs Freundschaft mit Schostakowitsch, von der beide Komponisten profitierten. Schostakowitsch „infizierte“ Weinberg mit der Liebe zu Gustav Mahlers Werk. Weinberg seinerseits zeigte seinem russischen Mentor die Welt der jüdischen Musik. Sie widmeten sich gegenseitig ihre Stücke. Schostakowitsch hat ein einleitendes Wort zum Klavierauszug der Passagierin geschrieben, der 1977 veröffentlicht wurde. Gwizdalanka listet alle bisherigen Inszenierungen dieser Oper auf, darunter die letzte in München (2024), bei der man aufgrund des andauernden Krieges in der Ukraine alle russischsprachigen Passagen aus dem Libretto entfernt hat. Das Buch endet mit einem Kalendarium des Lebens und Werks des Komponisten.
In Polen führte man seine Musik zum ersten Mal 1963 am Festival „Warschauer Herbst“ auf. Seine Sinfonie Nr. 2 dirigierte Kurt Sanderling 1965 mit dem Berliner Sinfonieorchester. Die Uraufführung der Oper Der Idiot nach dem Roman Dostojewskis hingegen fand 1991 statt, eine Woche vor dem Rücktritt Gorbatschows und dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums.
Mieczysław Weinberg pflegte zu sagen, dass jeder Moment im Leben eines Künstlers eine Arbeit ist, die fast nie endet. Man arbeitet nämlich nicht nur am Schreibtisch, sondern auch, indem man die Klänge, Farben, Bewegungen und Rhythmen der Wirklichkeit beobachtet und aufnimmt. Komponist zu sein ist ein ewiges Gespräch, eine ewige Suche nach Harmonie in Menschen und Natur, was den Sinn dieses kurzen Aufenthalts auf der Welt ergibt. Ich denke, jeder kreative Mensch kann diese Worte als sein Lebenscredo nehmen.
Jolanta Łada-Zielke, 12. Februar 2025, für
klassik-begeistert.de und klassik-begeistert.at
Die Buchangaben:
Danuta Gwizdalanka: „Der Passagier. Der Komponist Mieczysław Weinberg im Mahlstrom des zwanzigsten Jahrhunderts“
Titel der polnischen Ausgabe: Wajnberg
Verlag: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2024
Der Zyklus: Małe monografie
ISBN 978-83-224-5277-6
Die Homepage von Mieczyslaw-Weinberg-Institut:
Buchbesprechung „Mieczysław Weinberg. Auf der Suche nach Freiheit“ klassik-begeistert.de
Buchbesprechung: Ludwig Steinbach, Weinbergs Passagierin klassik-begeistert.de, 30. November 2024