J.S. Bach © wannapik.com
…wieso der Größte der Größten das größte Problem ist!
Irgendwann sollten eigentlich alle Klischees erkannt sein. Doch die Aufführungspraxis schafft stets neue. Es ist darum umso schöner, wenn eine Serie über solche Praktiken zu ihrem wohlverdienten Ende kommen kann. Also steigen wir zum vorerst letzten Mal ein in einen jener „Klassiker“, von denen man derart übersättigt wird, dass sie zu nerven beginnen. Von allen hier behandelten Werken ist dieses wohl eines der technisch ausgereiftesten. Dadurch ist aber auch dieses Stück Musik zu einer fast fundamentalistischen Stellung im Konzertbetrieb gelangt, der man nur noch teils sarkastisch, teils brutal ehrlich begegnen kann.
von Daniel Janz
Schnallen Sie sich an, denn hier kommt, was nicht kommen dürfte, was nicht sein kann, was Inbegriff der Unmöglichkeit ist: Blasphemie, Sakrileg, ja Königsmord in Form von Kritik am Gottvater aller Musik selbst: Johann Sebastian Bach!
In Zeiten, wo das Publikumssterben in den Konzertsälen eines der größten Probleme darstellt, fällt man nur zu gerne auf ebensolche Klassiker zurück, die mit enormer Kunstfertigkeit am Instrument eine dankbare Publikumsreaktion fast schon vorprogrammieren. Und gerade auch für Organisten zählt Bachs Toccata und Fuge in d-Moll wohl zu den am häufigsten gefragten Paradestücken. Dieses Stück dürfte in etwa so bekannt sein, wie Beethovens „Für Elise“, Mozarts „Eine kleine Nachtmusik“ oder Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ – wenn nicht bekannter.
Und wer könnte das verdenken? Wie dieses wenige Minuten lange Stück Musik quer durch die Hauptfunktionen einer Tonart durchsteigt, Harmonien wechselt, Themen verbindet, Ausdrücke von feinsinnig sensibel bis majestätisch tosend umfasst und am Ende sogar seinen Ohrwurmcharakter behält, ist größtmögliche Handwerkskunst.
Damit steht dieses Stück exemplarisch für das, was Johann Sebastian Bach bis heute zum weltbekannten Phänomen macht. Nach wie vor dürfte er der bedeutsamste Komponist aller Zeiten sein. Sein barocker Tonsatz ist genial, möglicherweise auf ewig unerreicht. Was er durch sein revolutionäres Erschließen aller uns heute bekannten Tonarten leistete, ist nach wie vor Grundlage all unserer Musik. Und selbst, wenn andere Komponisten einmal an sein Technikraffinesse herangekommen sein sollten – manchmal reicht es aus, der erste zu sein.
Johann Sebastian Bach setzte also Maßstäbe, die bis heute gelten. Damit ist er auch Teil des Problems. Denn der Umstand, dass seine Technik bis heute unerreicht ist, verdeutlicht umso mehr, das Musik mit viel simpleren Mitteln ähnliche, wenn nicht sogar stärkere Eindrücke hinterlassen kann.
Man muss nicht erst auf Beethovens Fünfte Sinfonie schielen, die mit ihrem simpelsten aller Themen einen ganzen Kosmos umfasst – immerhin ist dieses Werk selbst so ausgereift, das es als Blaupause einer ganzen Gattung gelten kann.
Aber der Blick auf die Popmusik zeigt, dass Technik nachrangig ist, um zu ergreifen. Diese Musik kennt häufig nicht einmal einen Tonartenwechsel, geschweige denn mehr als 3 Akkorde pro Song. Das ist in Noten gegossene Simplizität. Bach wäre für so ein primitives Geklimper und Gejaule nicht einmal aus dem Bett aufgestanden. Einen größeren Kontrast zu seinen Werken könnte es also kaum geben.
Trotzdem hat diese Musik heute ein Millionenpublikum, während Konzertsäle verwaisen. Bachs „hochwertige“ Musik illustriert damit perfekt das größte Problem der Klassik: Unsere so auf Technik fokussierte Musiktradition droht, Technik über Ausdruck, Tonsatz über Empfindung, Handwerk über Emotion zu setzen. Alles, was seit Bach für Orchester komponiert wird, wird direkt oder indirekt an ihm gemessen.
Über Bach kommt unsere Konzertmusik also nicht mehr hinweg, egal wie krampfhaft sie es versucht. Neukompositionen orientieren sich entweder an ihm und wiederholen, was er längst professionell erschöpft hat. Oder sie wenden sich komplett gegen alles und erschaffen mehr Chaos als Musik. Als gäbe es nichts dazwischen.
Die Folge sind trockene Zyklus-Kompositionen wie bei Brahms auf der einen Seite oder ideologische Verirrungen, wie bei Schönberg und Co. auf der anderen. Beides ist Musik, die das Publikum und besonders die Jugend aus dem Konzertsaal in die Arme von poppigen Simplisten jagt! Was Kenner also mit einer gewissen Berechtigung als Königsdisziplin der Klassik ehren, trifft bei jungem Publikum nur auf Unverständnis.
Dadurch sind aber auch die Gründe für unser Publikumssterben hausgemacht. Denn so abwechslungsreich und handwerklich durchdacht Bachs Toccata stellvertretend für ein ganzes Genre von Musik ist, so wenig spricht sie heute zu uns. Immer noch existiert die Ansicht, diese Musik könne man nur hören, wenn wir mit jahrelanger akademischer Bildung vor ihr sitzen und ehrfürchtig jeder Note mit vorauseilendem Gehorsam in der Partitur folgen. Das ist aber keine Musik zum Erleben und Spüren, sondern zum Lesen! Das muss doch langweilen, wenn parallel dazu bei Licht- und Nebelshow zum Beat des nächsten Popsternchens gegrölt wird!
Dennoch schuf Bach mit diesem Werk eine merkwürdige Ausnahme von der Regel. Denn obwohl seine Toccata und Fuge in d-Moll vollständig durchstrukturiert ist, liegt ihr auch ein enormer expressiver Charakter inne. Darüber hinaus ergießt sie sich nicht im Formfetischismus, wie bei seinen Nachfolgern. Hier bleibt Form Mittel zum Ausdruck, weshalb er in dieser Disziplin bis heute unübertroffen ist. Das ändert aber nichts daran, dass selbst dieses Ausnahmewerk streng genommen eine akademisch-musikalische Finger- und Fußübung ist – böse Zungen würden sagen: „tote Musik“.
Wozu braucht es Fugen und trockene Themengestaltung, wenn damit nicht auch eine Geschichte erzählt oder eine Empfindung geweckt wird? Musik zum Selbstzweck ist irgendwann nur noch das: Selbstzweck. Verliert sie aber den Ausdrucksgehalt ihrem Publikum gegenüber, macht sie sich selbst überflüssig.
Daniel Janz, 17. August 2025, für
klassik-begeistert.de und klassik-begeistert.at

Daniel Janz, Jahrgang 1987, Autor, Musikkritiker, Komponist, Stipendiat, studiert Musikwissenschaft im Master:
Orchestermusik war schon früh wichtig für den Sohn eines Berliner Organisten und einer niederländischen Pianistin. Trotz Klavierunterricht inklusive Eigenkompositionen entschied er sich zunächst für ein Studium der Nanotechnologie, später Chemie, bis es ihn schließlich zur Musikwissenschaft zog. Begleitet von privatem Kompositionsunterricht schrieb er 2020 seinen Bachelor über Heldenfiguren bei Richard Strauss. Seitdem forscht er zur Verbindung von Musik und Emotionen und setzt sich als Studienganggutachter aktiv für Lehrangebot und -qualität ein. Seine erste Musikkritik verfasste er 2017 für klassik-begeistert. 2020 erregte er zusätzliches Aufsehen durch seine Kolumne „Daniels Anti-Klassiker“. Mit Fokus auf den Raum Köln/Düsseldorf kann er inzwischen auch auf musikjournalistische Arbeit in Österreich, Russland und den Niederlanden sowie Studienarbeiten und Orchesteraufenthalte in Belgien zurückblicken. Seinen Vorbildern Strauss und Mahler folgend geht er der Frage nach, wann Musik ihre angestrebte Wirkung und einen klaren Ausdruck erzielt.
Daniels Anti-Klassiker 59: Beethovens Mondscheinsonate klassik-begeistert.de, 3. August 2025
Daniels Anti-Klassiker 57: „Star Wars“ klassik-begeistert.de, 2. März 2025
Daniels Anti-Klassiker 56: Strawinskys „Sacre du printemps“ klassik-begeistert.de, 26. Januar 2025

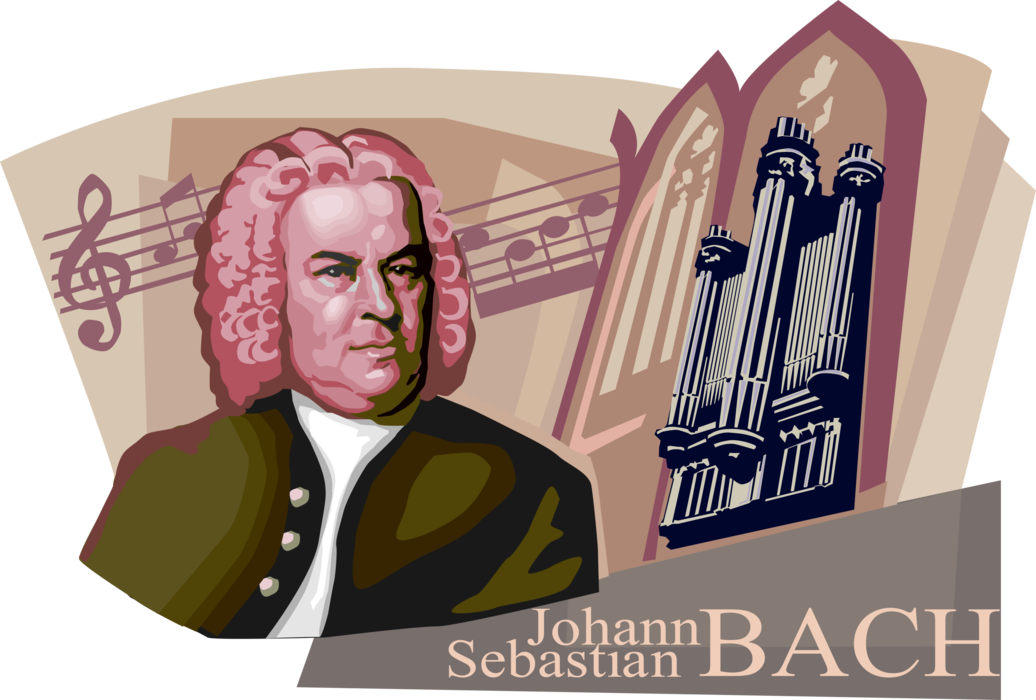
Lieber Herr Janz,
selten habe ich eine so gute Analyse über klassische Musik im Vergleich zu populärer Musik gelesen. Haben Sie herzlichen Dank für Ihre ausgefeilten Beiträge über sog. Anti-Klassiker. Daraus ließ sich viel lernen.
Ihr Ralf Wegner