Bild: Der Schrei, Edvard Munch, 1893, Norwegische Nationalgalerie, de. wikipedia.org
Fast alle sind ob der souverän getroffenen Entscheidung des Amsterdamer Concertgebouworkest, Klaus Mäkelä zum Chefdirigenten zu küren, völlig aus dem Häuschen. Sein Eröffnungskonzert des Berliner Musikfests wird allenthalben als fulminantes Ereignis gefeiert. Nur ein ehrenwertes Presseorgan mäkelt in bewährter früher-war-alles-besser-Manier vor sich hin, doch schlimmer noch: Es entgleist diesmal regelrecht. Man ist schockiert und fragt sich: Sollte man auf eine solche Unverschämtheit überhaupt reagieren, ihr dadurch Aufmerksamkeit schenken? Unbedingt! Denn es geht auch um Umgangsformen, und gerade auf diesem Gebiet ist auch Deutschland noch ein Entwicklungsland.
von Brian Cooper, Bonn
Unmittelbar vor dem ersten der beiden Abende mit dem Concertgebouworkest in Köln – sehr aufregende Woche gerade – wurde mir ein FAZ-Artikel in die Hand gedrückt. Dessen Überschrift: „Chefdirigent weiterhin gesucht“. Und dann: „Der Auftritt von Klaus Mäkelä beim Musikfest Berlin stellt dessen überforderte Jugend bloß: ein Desaster fürs Concertgebouworkest.“
Das erinnert beängstigend an einen Artikel aus der Prawda vom Januar 1936 mit dem Titel „Chaos statt Musik“, und ich kann nun besser nachvollziehen, wie sich Dmitri Schostakowitsch bei der Lektüre gefühlt haben dürfte. Da wird jemandem ohne Not und in einem äußerst unangenehmen Tonfall die künstlerische und damit auch (im Falle des Musikers) die berufliche Kompetenz abgesprochen.
Dasselbe Programm wie in Berlin hatte ich bereits am 19. August 2022 in Amsterdam gehört und war nicht der Einzige, der schrieb, eine neue Ära sei möglicherweise in Sicht. Nun wird sich ein Orchester binnen neun Tagen kaum derart verschlechtern. Was also ist da los? „Wahrscheinlich schon wieder so einer, der mit nichts zufrieden ist“, denke ich mir, eh ich weiterlese, „da könnte selbst der liebe Gott auftreten, es würde verrissen.“
Clemens Haustein (FAZ vom 30. August 2022, S. 11) moniert an Mäkeläs Dirigierstil, dieser lasse „keinen Akzent, kein überfallartiges Crescendo ungenutzt vorüberziehen“. Mein Eindruck war ein gänzlich anderer: Mäkelä dirigiert energiegeladen, ja, aber es ist eine Augenweide, und er betreibt eben kein micromanagement, sondern hat stets das große Ganze im Blick. Und das klangliche Resultat erinnerte mitunter frappierend an jene bedeutenden Mahler-Abende im Concertgebouw, beispielsweise unter Haitink und Jansons.
Nun hat hierzulande glücklicherweise jeder Mensch das Recht auf seine Meinung und darauf, diese kundzutun – auch wenn eine beängstigende Zahl von Querschwurblern allein dieses Faktum schon bestreiten würde. Aber um die geht es hier nicht.
Man darf auch durchaus als Einziger einen Konzertsaal ratlos verlassen. So etwas ist mir auch schon passiert: Gefühlt alle jubelten; ich war konsterniert. Es gibt diese Abende.
Aber dass Mäkeläs Mahler beim Eröffnungskonzert des Berliner Musikfests so desaströs gewesen sein soll, dass er gar, wenn man zwischen den Zeilen liest, den falschen Beruf ergriffen zu haben scheint – eine Partitur kann er schon lesen, der gute Junge, das immerhin wird ihm konzediert –, darauf findet man in der sonstigen deutschen Presselandschaft keinen weiteren Hinweis. Jubel allenthalben: Tagesspiegel, Morgenpost, Süddeutsche, RBB online und so fort.
Was ist der Grund für ein solches Massaker von Kritik, für eine solche Entgleisung, für ein derartiges train wreck von journalistischem, pardon, Unfug? Mäkelä hat nicht in der Provinz begonnen wie viele Große – tja, dann ist das eben so!
Der Mann kann nichts für sein Alter. Er ist 26, ja, und seinen bisherigen Erfolg hat er sich gewiss, zumal als Schüler von Jorma Panula, hart erarbeitet. Er hat eine klare Linie, er erfasst die gesamte Architektur der riesenhaften Sechsten, und – das ist entscheidend – er bekommt vom Orchester, was er will.
Je konservativer die Zeitung, desto mehr „früher-war-alles-besser“-Arroganz konstatiert man oft. Das ist nicht neu. Ebenso erwartbar ist in derartigen Feuilletonbeiträgen, dass reflexhaft der Name Karajan bemüht wird.
Aber von einem „Ärgernis“ zu sprechen, von „Lärmbelästigung“ gar, und dass man als Orchester so nicht auftreten dürfe, „schon gar nicht auf Tournee“, dass überhaupt die ganze Wahl zum Chef – wohlgemerkt offiziell erst ab 2027, ein kluger Schachzug – ein Desaster sei: All dies wäre nur dann legitim, wenn das musikalische Ergebnis schwach wäre. Ist es aber nicht. Im Gegenteil.
Wenn ein bedeutendes Orchester sich mehrere Jahre Zeit nimmt, bevor es seinen neuen Chef verkündet, schreien die üblichen Verdächtigen Zeter und Mordio, allen voran ein einschlägiger, berüchtigter Klassik-Blog in englischer Sprache mit vielen Informanten, doch von zweifelhaft-ungenauem journalistischen Ruf. Versagen wird dem Management gern angedichtet, von Problemen ist die Rede – diese mögen existiert haben oder auch nicht: Woher wissen das alle so genau? –, ebenso von „Ratlosigkeit“, wie im zitierten FAZ-Beitrag. Alle wissen es besser.
Festzuhalten bleibt: Ein Weltklasse-Orchester hat eine in mehrfacher Hinsicht souveräne Entscheidung getroffen! Die Jahre, die ins Land gehen, werden zeigen, ob es eine Ära wird. Die Vorzeichen stehen dafür gut. Und die Nörgler? Die wird es immer geben. Insbesondere hierzulande ist’s ein Volkssport.
Wir sollten mal alle ganz schnell und ganz dringend in uns gehen und uns fragen, wie wir miteinander umgehen wollen. Verschiedene Meinungen und Kritik sind wichtig, aber angesichts des derzeitigen Zustands der Welt sollte auch der Ton wieder respektvoll werden. Zweifel kann man auch moderater formulieren.
Dr. Brian Cooper, 31. August 2022, für
klassik-begeistert.de und klassik-begeistert.at

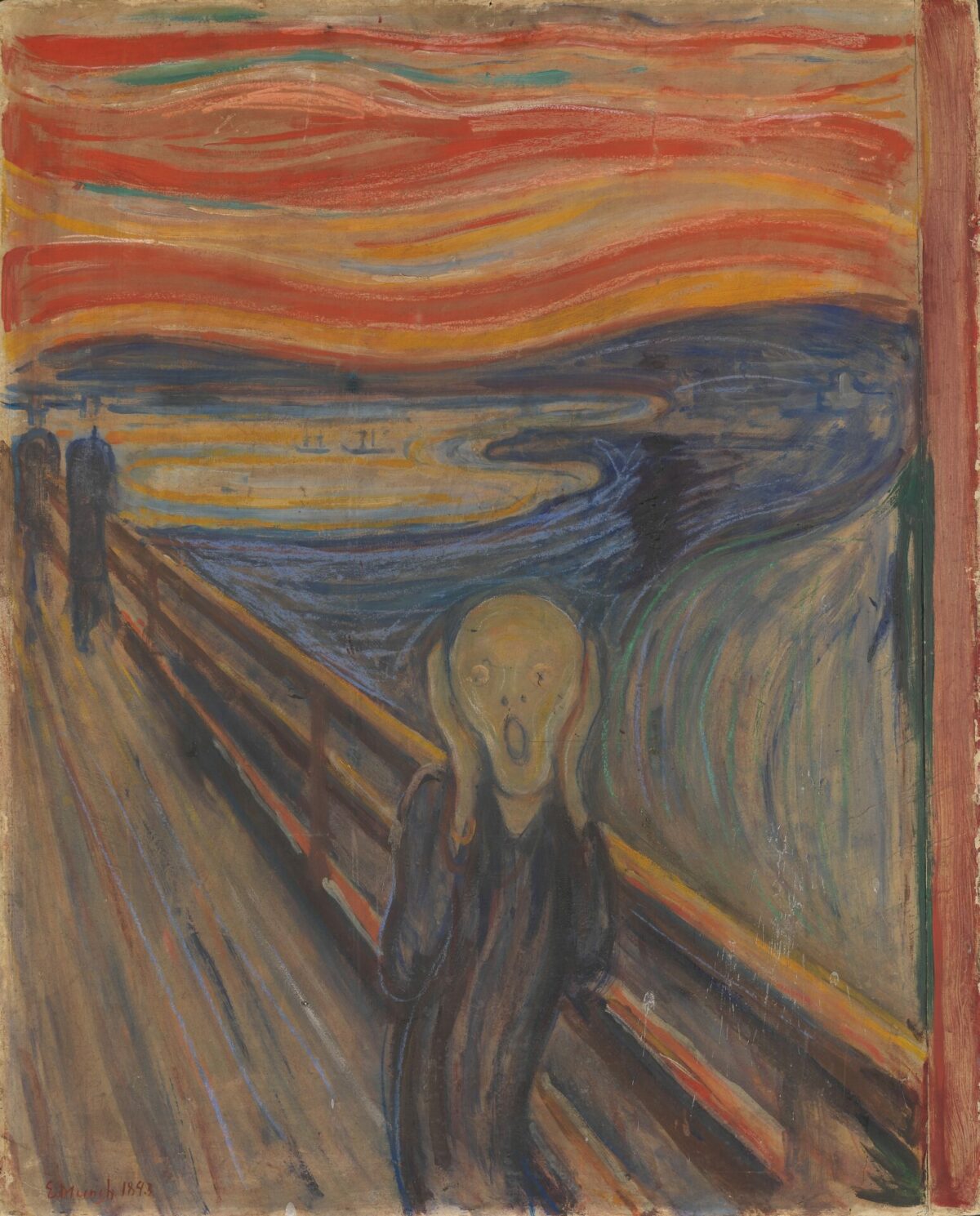
„Jubel allenthalben: Tagesspiegel, Morgenpost, Süddeutsche, RBB online und so fort.“
Mich hat noch nie beeindruckt, was andere von sich geben.
Über das Konzert von Herrn Mäkelä kann ich nicht mitreden. Ich habe es nicht gehört.
Dieser uneingeschränkte Jubel erinnert mich allerdings an den Einstand von Kirill Petrenko als neuer Chef der Berliner Philharmoniker kurz vor Corona. In den konnte ich definitiv nicht einstimmen, ich fand Petrenkos Tschaikowski- und Beethoven-Wiedergaben einfach nur grässlich laut und schnell. Und ich fand es erbärmlich, dass das außer mir offenbar kaum ein Journalist bemerkte.
Woran sich ein Urteil bemisst, hängt freilich von Ansprüchen und Vergleichs-Maßstäben ab, die sich im Laufe von Jahrzehnten bilden. Umso länger und intensiver jemand am Konzertleben teilnimmt, desto höher werden die Ansprüche. Wer beispielsweise nie einen Furtwängler, Celibidache, Bernstein, Toscanini, Muti oder Thielemann gehört hat (sei es nun live oder auf Aufnahmen), wird sich sehr wahrscheinlich schon mit mittelmäßigeren Leistungen zufrieden geben. Das liegt in der Natur der Sache.
Ich habe noch Zeiten erlebt, in denen in der überregionalen Tagespresse ganz konträre Positionen vertreten wurden, wo man dachte, die Kritiker wären in verschiedenen Aufführungen gewesen. Da machte es noch Sinn, beim morgendlichen Frühstück in den Feuilletons zu blättern, das war spannend. Heute steht meist überall mehr oder weniger dasselbe, manchmal scheint es, ein Surfer des Zeitgeists schreibe vom anderen ab.
Zum Glück gibt es noch ein paar gestandene Persönlichkeiten wie Herrn Haustein, die unbeirrt zu ihrem Klartext stehen. Im Ton vergriffen hat sich der Kollege jedenfalls auf keinen Fall.
Wer für Meinungsfreiheit steht, hat keinen Grund, an dem FAZ-Artikel Anstoß zu nehmen.
Vergessen wir nicht die Geschichte von den „Kaisers neuen Kleidern“, in der nur ein Kind den Mut aufbringt zu sagen, der Kaiser habe ja gar nichts an.
Kirsten Liese, Kulturjournalistin, Berlin
Mit Verlaub, liebe Frau Liese, ich teile diese Einstellung nicht.
Die FAZ fällt mir schon seit Monaten sehr negativ auf: Mit tendenziöser Berichterstattung, einer Sichtweise, die sich oft mit Fakten beißt oder einem Schreibstil, der andere bewusst versucht in ihrer Ehre zu verletzen oder sie zu denunzieren. Egal, ob ich in deren Nachrichten-, Wirtschafts- oder Unterhaltungsteil schaue – häufig, wenn ich die FAZ lese, kommt es mir vor, als würde ich Propaganda für ein ganz bestimmtes Metier und ein ganz bestimmtes, sehr konservativ/kapitalismusverherrlichende Klientel lesen.
Bezogen auf das Konzert in Berlin möchte ich sagen: Auch ich war nicht dabei. Und Kritik kann gut und richtig sein. Oft sind mir Kritiken anderer Autoren auch zu zahm oder nichtssagend. Es ist dann aber auffällig, wenn eine Person von einem wahren Meisterwerk spricht (wie hier auf klassik-begeistert geschehen: https://klassik-begeistert.de/musikfest-berlin-2022-concertgebouw-orkest-amsterdam-klaus-maekelae-philharmonie-berlin-28-august-2022/) und eine andere dasselbe Event zu einem regelrechten Desaster stilisiert. Solche Extreme passen nicht zusammen, das kann nicht beides wahr sein. Oder mit anderen Worten: Einer muss lügen. Und ich bin geneigt, diese Lüge der FAZ zuzuschreiben, denn andere Berichte stellen klar, dass das Publikum von der Vorstellung überzeugt war.
Zu Kritik – besonders negativer – gehört, dass man sie auch gut begründet. Das war meiner Auffassung nach im Beitrag der FAZ nicht unbedingt der Fall.
Und ich finde, es gehört zum guten Tenor, anderen Menschen dabei ihre Ehre zu lassen. Meinungsfreiheit hin oder her. Man kann nahezu alles sagen. Aber sollte man das auch?
Ich würde mir wünschen, dass sich mehr Menschen diese Frage wieder stellen würden. Denn Worte haben Konsequenzen, wie wir ja auch daran sehen, dass klassik-begeistert gerade in einem anders gelagerten Fall wegen (angeblich zu negativ) kritischen Äußerungen juristisch gedroht wird:
https://klassik-begeistert.de/giuseppe-verdi-aida-grosses-festspielhaus-salzburg-27-august-2022/
Das ist wohl das andere Extrem und lässt bereits Zensurdebatten aus eigentlich vergangen gedachter Zeit wieder aufleben. Das braucht es genauso wenig, wie so einen vermeintlichen Unsinn in der FAZ.
Fazit daher: Ich finde diesen Beitrag von Herrn Dr. Brian Cooper nicht nur berechtigt, sondern notwendig!
Daniel Janz
Sehr geehrter Herr Janz,
was ich zunehmend beobachte ist die Tatsache, dass es immer weniger (vor allem junge Journalisten) gibt, die eine eigene Meinung vertreten, viele sind sehr unsicher und haben in Ermangelung des Vergleichs bescheidene Maßstäbe.
Es gehört etwas dazu, eine eigene Meinung gegen den Rest der Welt zu vertreten, ich weiß wovon ich rede, wurde ich auch schon mehrfach zensiert. Und gehe trotzdem unbeirrbar meinen Weg weiter.
In der breiten Masse mitschwimmen – das tun nur die journalistischen Leichtgewichte.
Es geht mir dabei nicht unmittelbar um eine künstlerische Leistung, die ich nicht beurteilen kann, sondern um den Mut, gegen den Strom zu schwimmen, was sich leider nur wenige trauen.
Nebenbei gesagt kommt mir die Argumentation von Herrn Haustein sehr wohl glaubwürdig vor, wenn er bemerkt, die Düsternis in Mahlers Musik würde sich nicht vermitteln. Ich kann mir schwer vorstellen, dass ein so junger Dirigent in diese Abgründe schon eintauchen kann, ein Claudio Abbado nach seiner schweren Erkrankung war da unweigerlich schon ganz anders prädestiniert.
Ich kann im Übrigen gar nicht finden, dass die FAZ „konservativ/kapitalismusverherrlichende Propaganda“ veröffentlicht, mir kommen die Berichte da – wo ich mitreden kann – meist wesentlich profunder und nachvollziehbarer vor als in anderen Publikationen.
Kirsten Liese