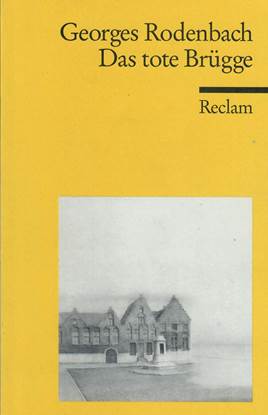„Das tote Brügge“ Rodenbachs Roman
Es kommt in der Oper ganz anders. Sie lässt Licht am Ende des Tunnels erblicken.
von Lothar und Sylvia Schweitzer
Der Roman, wir neigen dazu das Werk als Novelle zu bezeichnen, endet vernichtend, ohne Hoffnung. „Die beiden Frauen waren wieder zu einer verschmolzen. So ähnlich sie im Leben gewesen waren, im Tod waren sie sich doppelt ähnlich. Der Tod hatte die nämliche Blässe auf beide gelegt. Sie waren das zweieinige Gesicht seiner Liebe.“
Wie bei Carlo Gozzis „Turandot“ werden bei der Dramatisierung Personen neu eingeführt bzw. profiliert.
In Rodenbachs Novelle gibt es im Wesentlichen als namentlich handelnde Personen nur den Witwer Hugo und das „Double“ seiner verstorbenen Frau, eine Tänzerin mit Namen Jane. Hugos Frau wird als „der Toten“ gedacht. Als dritte Person kommt noch die Haushälterin Barbe dazu, die es mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren kann die Liebschaft als Gast zu bedienen und ihren früher verehrten Herrn verlässt.

In der Korngold-Oper treten die potentiellen Rivalen des Witwers Paul namentlich und gesanglich als libertinistische Künstlerkollegen der Tänzerin auf, nicht nur als schemenhaftes Ergebnis seiner Befürchtungen. Seine verstorbene Frau trägt den Namen Marie, bezeichnenderweise ihr lebendes Pendant die Verkleinerungsform Marietta. Der Schluss des ersten Bilds bringt als berührende Szene die Erscheinung Maries und wird von der Interpretin der Marietta gesungen. Dem Leben gut abgeschaut ist der auf Pauls Emotionen kritisch reagierender Freund Frank. In der zweiten Szene des ersten Bilds verdichtet sich das mystische Erlebnis Pauls, das er seinem Freund Frank anvertraut. Anlass ist ein Besuch von Frank, der beim Blick auf ein Porträt Maries bemerkt: „Sie war schön.“ Und Paul antwortet: „Sie war schön, sagst du? Sie ist schön! Ist!“ Und sein Tenor in Erzählform beginnend entwickelt immer mehr Gefühle und Stimmungen: „O hör ein Märchen an, ein wunderbares Märchen! … Täglich schritt ich gleichen Weg, zum Minnewasser, auf die Fläche starrend, ihr teures Bild mit Tränen mir ersehnend. … Ein Schatten gleitet übers Wasser. Ich blicke auf: Vor mir steht eine Frau im Sonnenlicht, erglänzt Mariens goldnes Haar, den Lippen entschwebt Mariens süßes Lächeln. Nicht Ähnlichkeit, mehr – nein, ein Wunder, Begnadigung! Es schien sie selbst, mein Weib!“ „Ich weiß nicht, wer sie ist, lud sie zu mir in meine Einsamkeit. Sie kommt und in ihr kommt mir meine Tote, kommt Marie.“
Rodenbach schildert diese schicksalhafte Begegnung in zweieinhalb Kapiteln. Auch er erzählt, dass Hugo bei seinen Spaziergängen ihr „Ophelienantlitz“ in der sanften Strömung der Kanäle hatte treiben sehen und Selbstmord in Erwägung zog. Aber an dem biografisch bedeutenden Tag besuchte er in der Kirche Notre Dame, wie so oft, die Sarkophage Karls des Kühnen und Marias von Burgund, nebeneinander schlafend. Auf dem Heimweg versuchte er immer der Gestalt auf Marias Sarkophag die Züge seiner Frau zu leihen. Sein Blick war dabei nach innen gekehrt. Doch sonst auf die Vorübergehenden nicht achtend sah er eine junge Frau auf sich zukommen. „Es war wie ein Donnerschlag, eine überirdische Erscheinung. Hugo war einen Augenblick dem Umfallen nahe.“ „Diese Emailhaut, diese großen schwarzen Pupillen – alles dasselbe. Und wie er hinter ihr herging, sah er ihre Haare am Hinterkopf unter dem schwarzen Hut hervorkommen. Die gleiche Goldfarbe, also derselbe Kontrast.“ „Und dann sah er sie plötzlich nicht mehr.“

Ein Roman kennt andere Zeitmaße. Eine Woche enttäuschten Erwartens an der gleichen Stelle bis er sie am gleichen Wochentag wieder trifft. Der Weg führt ins Zentrum, zum Theater. Diesmal verliert er sie bei ihrem Eintritt ins Theater aus den Augen. Sie spielen Meyerbeers Robert der Teufel. „Sie musste sogleich im Saal erscheinen. Sie wiederfinden! Sie sehen! Sie deutlich einen Abend lang betrachten! Ohne zu zaudern verlangte er einen Fauteuil-Platz. Sein Auge durchlief rasch alle Plätze, das Parkett, die Ränge und die Logen, die sich allmählich füllten. Er fand sie nicht wieder.“ Da blitzte ihm ein Gedanke auf: „Konnte sie nicht auf der Bühne erscheinen? Akt für Akt ging vorüber, ohne dass er sie erblickte. Er erkannte sie nicht wieder, weder unter den Sängerinnen noch unter den wie Holzpuppen geschminkten Choristinnen. Doch als Helena aus ihrem Grab erwacht, Leichentuch und Kutte abwirft, da empfand Hugo eine Erschütterung. Ja das war sie! Eine Tänzerin. Aber das kam ihm gar nicht in den Sinn. Es war die Tote, die aus ihrem Grab aufstand, seine Tote.“
Paul singt zu dem seine Bedenken äußernden Freund Frank: „Und heute Mittag sprach ich sie, bebenden Herzens, zweifelswund – und der Wunder allergrößtes: Mariens Stimme klang aus ihrem Mund!“
Rodenbach führt erzählerisch weiter aus. Eine längere Zeit zögerte er sie anzusprechen (wie Paul zum Ausdruck bringt: „bebenden Herzens, zweifelswund) und war dann durch ihre Natürlichkeit überrascht. Die Klangfarbe beschreibt der Dichter als Metallmischung. Im vierten Kapitel lesen wir: „Auch in ihrem Wesen lag nichts von der ungebundenen Art der Tänzerinnen. Eine einfache Kleidung, ein anscheinend zurückhaltender, sanfter Geist.“ Bei Rodenbach macht der erste Besuch Janes im Haus Hugos erst am Ende der Novelle die Tragödie unabwendbar. Lange wollte er das Geheimnis seiner Witwerschaft und den Totenkult um seine Frau in seinem Haus verbergen.
Die fünfte und sechste Szene im ersten Bild folgen nicht der Novelle. Aber sie beinhalten, wie wir bald sehen werden, das Kostbarste der Oper. Auf dringliches Bitten Pauls hat seine Begegnung die Einladung angenommen, ist, von Marietta sehr direkt ausgedrückt, hergelockt worden. Sie hat auch keine Hemmungen ihn aufgrund der Einrichtung unverblümt als reich zu taxieren. Aber Paul scheint diese Untertöne nicht zu hören, schaut bloß auf ihre Erscheinung: „Die Sonne lacht in diesem Haar.“ Flüchtig fällt ihr Blick auf die Bilder und Fotografien seiner verstorbenen Frau und sie fällt ihm ins Wort: „Und hier bescheint sie Bilder schöner Damen. Bin ich nicht schön? Nicht schöner als die alle?“ Paul möchte sie mit dem Seidenschal, den seine Frau trug, bewundern. Unwillkürlich ruft er: „Marie!“ Sie: „Marie? Ich heiße Marietta.“ Paul reicht ihr die Laute, auf der Marie gespielt hat. Sie glaubt, er sei Maler und suche ein Modell. Einer Laune folgend sucht sie sich zu einer alten Laute ein altes und trauriges Lied aus. Es erklingt das Lied vom treuen Lieb, das sterben muss. Sie hatte nicht die Absicht, dass dieses Lied ihrem Gegenüber sichtlich so zu Herzen geht. Paul: „Es hat noch eine Strophe.“ Er setzt mechanisch fort, sie spielt die Laute und fällt ein. Sie merkt seine Erschütterung: „Das dumme Lied, es hat sie ganz verzaubert.“ Von draußen hört sie ihre Theatertruppe und ist froh ein fröhliches Lied zu hören. „Ihr werter Griesgram“ erfährt, dass sie Tänzerin ist und ins Theater muss. Allein gelassen erscheint in der sechsten Szene Marie (gesungen von der Sängerin der Marietta) und man hört Marie, Paul und dann wieder Marie: „Hältst du mir die Treu?“ – „Du bist bei mir …“ – „Und doch wirst du vergessen, was neben dir nicht lebt und atmet.“ So haben wir immer wieder, wenn der Vorhang nach dem ersten Bild fällt, das Gefühl gerade das Rührendste und Schönste, den Höhepunkt der Oper erlebt zu haben.
In Rodenbachs „Das tote Brügge“ ist es nicht der Schal, es erfasst ihn die Idee, es solle zur Gleichheit des Gesichts, des Körpers und der Stimme noch die Kleidung treten. Er brachte ihr mit einem etwas bangen Gefühl in einem Koffer zwei Kleider der Toten und war beruhigt über ihre hocherfreute Miene. Doch beim Auspacken musste er ihre Enttäuschung über die Mode vergangener Jahre erleben. Da brach in ihr die Schauspielerin durch und sein Geschenk belustigte sie als Maskerade. Rodenbach beschreibt im neunten bis zwölften Kapitel die schleichende Desillusion: „Es hatte mit der Ähnlichkeit des Gesichts begonnen. Als er dann die beiden Frauen verschmelzen wollte, traten die Unterschiede zu Tage. Er verglich beide mit immer peinlicherer Genauigkeit und schob ihr die Schuld zu, wenn er sie anders sehen musste. Ein Rückstand von Theaterblut trat zutage, nachdem sie ihm zuliebe von der Bühne Abstand nahm. Recht freie Redensarten waren von ihrer Seite immer stärker geworden. Aber er kam immer noch zu ihr, um das entschwindende Zauberbild zu bannen. Es drängte ihn, diese Stimme zu hören, gleichzeitig litt er an dem, was sie sagte. Sie fand ihn langweilig, verspätete sich gern am Abend. Er selbst wanderte ziellos durch die Stadt. Jane hörte auf das genaue Ebenbild der Toten zu sein und die Stadt wurde wieder zur soror dolorosa. Er fühlte sich wie ein entlaufener Mönch und trachtete erneut zum Ebenbild der Stadt zu werden. Die Unähnlichkeit trat von Tag zu Tag mehr hervor. Wenn er sie vom theatralischen Sich-Anmalen abbringen wollte, reagierte sie höhnisch. Es handelte sich nicht mehr um die Tote, die so gut war, sondern allein um sie. Aber es fehlte ihm die Kraft mit seinem Trugbild zu brechen und sein einsames Leben wieder anzufangen. Er lernte das heimliche Auflauern kennen, das nächtliche Postenstehen im Wind, die Befürchtung, das Schattenbild hinter den Vorhängen könnte sich verdoppeln.“

Hier setzt das zweite Bild ein und in der zweiten Szene sieht er Frank sich dem Haus Mariettas nähern und muss sich von seinem Freund sagen lassen: „Lass ab von ihr! Du passest nicht zu ihr.“ In der Szene darauf tritt die Theatertruppe einschließlich ihres gräflichen Mäzens mit Marietta auf, die genießt, dass ihr die Männer den Hof machen: „Ich komm zu den Meinen, ich komm zu gefallen, lasse den Einen, schenke mich Allen!“ Aus Lust und Laune spielen sie auf offener Straße die Auferstehung der Helena aus „Robert der Teufel“ persiflierend nach. Bei Rodenbach ist diese Szene auf der Bühne des Theaters Baustein des schicksalhaften Ereignisses, bei Korngold erlebt Paul diese als Sakrileg. Er stürzt aus seinem Versteck hervor, mit einem eisernen Griff Marietta fassend: „Du! Du! Eine auferstandene Tote? Nie!“ Marietta pocht auf ihre Freiheit und Paul außer sich: „Erniedrigt hast du mit deiner Niedrigkeit, betrogen meinen Traum.“ Darauf Marietta trocken: „Dann geh, ich halt dich nicht.“ Jetzt hält sich Paul nicht mehr zurück: „Glaubst du, ich liebte dich? Ich küsste eine Tote nur in dir, liebkost in deinem Haar nur das der Andern, erlauscht in deiner Stimme nur die ihre.“ Seine Hassausbrüche gehen in Verzweiflung über und diese Schwäche nützt sie geschickt aus: „Im Haus der Toten suche ich dich auf, zu bannen das Gespenst für immer. Ich will zu dir!“
Das dreizehnte Kapitel des Buchs erzählt es eindeutiger und härter. Sie hatte erkannt, welche Macht sie über diesen Mann gewonnen hatte. Ein Mann, durch langen Kummer entkräftet, der sich in den letzten Monaten so verändert hatte, konnte nicht mehr lange leben. Welche Torheit, sich diese Erbschaft entgehen zu lassen! Sie lenkte ein, ging weniger oft aus. Eine von seinen Fenstern gut einsehbare Prozession nahm sie zum Anlass sich zum ersten Mal bei ihm umzusehen. Bisher hat er erfolgreich vermeiden können sie bei sich einzuladen. Dem vorgetäuschten Wiederaufflammen ihrer Leidenschaft erlag er.
Das letzte, fünfzehnte Kapitel und die erste und zweite Szene des dritten Bilds führen wieder zusammen, ins Haus des Witwers Paul. Pompös wirkt von draußen die Prozession herein. Durch Paul werden wir in die ekstatische, religiöse Feierlichkeit hereingenommen: „Berauschend wogt die farbige Flut. Und unter schwankendem Baldachin der Bischof trägt den goldenen Schrein.“ Und Marietta halb ironisch, halb wie mit neu erwachtem Interesse: „Du bist ja fromm. Ja wer dich liebt, muss teilen mit Toten und mit Heiligen.“ Marietta fühlt sich durch die Tote erniedrigt. Sie erblickt die Kristalltruhe mit der Haarflechte Maries. Wir haben noch heute vor Augen, wie Karan Armstrong Pauls „Allerheiligstes“ tanzend wie ein Lasso schwingt, Maries Haar ihrem Partner Thomas Moser hinhält und wieder entzieht, bis sie der Verzweifelte erfasst und erdrosselt.
Es wird dunkel. Wenn sich die Bühne allmählich erhellt, finden wir alles so vor wie beim Abgang Mariettas im ersten Bild. Paul in seinem Fauteuil eingeschlafen erwacht und erkennt seine Haushälterin Brigitta „in alter Lieb und Treu“. Marietta tritt herein, weil sie Schirm und Rosen vergessen hat. Sie äußert den Gedanken, ob sie das für ein Omen nehmen soll da zu bleiben. Doch Paul reagiert nicht. Beim Weggehen trifft sie auf den eintretenden Freund Frank, der Paul die Melodie des Lautenlieds wieder aufnehmend mitteilen hört: „Ein Traum hat mir den Traum zerstört.“ Wieder allein gibt Paul dem Schluss der zweiten Strophe eine neue Gestalt. Hieß es „Musst du einmal von mir gehn, glaub, es gibt ein Auferstehn.“ Jetzt hören wir als die letzten Verse: „Harre mein in lichten Höhn, hier gibt es kein Auferstehn.“
Im Nachwort zur Reclam-Ausgabe „Das tote Brügge“ bringt der Kunsthistoriker Günter Metken den Dichter Rodenbach in die Nähe der Dekadenzdichtung. Hier spricht Hugo nach seiner affektiven Tat immerfort vor sich hin: „Tot, tot … Tote Stadt.“
In „Opern und ihr Sitz im Leben“ (Schweitzers Klassikwelt 33) erwähnten wir die Lebensbeichte eines Freundes. Als eine gute, mit der Person des Frank zu vergleichende Bekannte von seiner aufwühlenden Begegnung erfuhr, fragte sie ihn damals: „Ist das ein Engel oder eine Versuchung?“ Bei Korngold kommt es durch den Übergang eines Teils der Geschichte in einen erschreckenden, aber heilsamen Traum zu einer Katharsis.
Lothar und Sylvia Schweitzer, 8. März 2022, für
klassik-begeistert.de und klassik-begeistert.at
Schweitzers Klassikwelt (c) erscheint jeden zweiten Dienstag.

Lothar und Sylvia Schweitzer
Lothar Schweitzer ist Apotheker im Ruhestand. Gemeinsam mit seiner Frau Sylvia schreibt er seit 2019 für klassik-begeistert.de: „Wir wohnen im 18. Wiener Gemeindebezirk im ehemaligen Vorort Weinhaus. Sylvia ist am 12. September 1946 und ich am 9. April 1943 geboren. Sylvia hörte schon als Kind mit Freude ihrem sehr musikalischen Vater beim Klavierspiel zu und besuchte mit ihren Eltern die nahe gelegene Volksoper. Im Zuge ihrer Schauspielausbildung statierte sie in der Wiener Staatsoper und erhielt auch Gesangsunterricht (Mezzosopran). Aus familiären Rücksichten konnte sie leider einen ihr angebotenen Fixvertrag am Volkstheater nicht annehmen und übernahm später das Musikinstrumentengeschäft ihres Vaters. Ich war von Beruf Apotheker und wurde durch Crossover zum Opernnarren. Als nur für Schlager Interessierter bekam ich zu Weihnachten 1957 endlich einen Plattenspieler und auch eine Single meines Lieblingsliedes „Granada“ mit einem mir nichts sagenden Interpreten. Die Stimme fesselte mich. Am ersten Werktag nach den Feiertagen besuchte ich schon am Vormittag ein Schallplattengeschäft, um von dem Sänger Mario Lanza mehr zu hören, und kehrte mit einer LP mit Opernarien nach Hause zurück.“