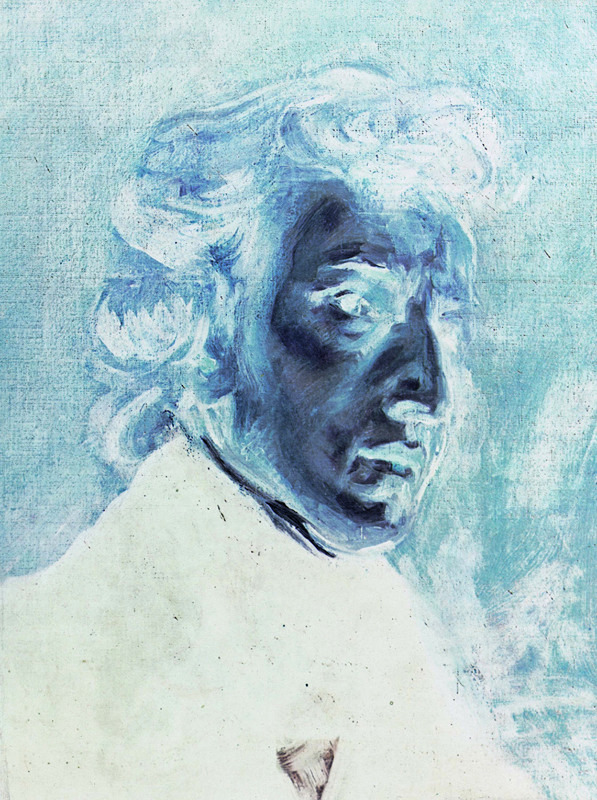Höchste Zeit, sich als Musikliebhaber neu mit der eigenen CD-Sammlung und der Streaming-Playlist auseinanderzusetzen. Dabei begegnen einem nicht nur neue oder alte Lieblinge. Einige der „Klassiker“ kriegt man so oft zu hören, dass sie zu nerven beginnen. Andere haben völlig zu Unrecht den Ruf eines „Meisterwerks“. Es sind natürlich nicht minderwertige Werke, von denen man so übersättigt wird. Diese sarkastische und schonungslos ehrliche Anti-Serie ist jenen Werken gewidmet, die aus Sicht unseres Autors zu viel Beachtung erhalten.
von Daniel Janz
Ahja Chopin. Einer der verklärten Könige in der Kunst des Klavierspiels. Seine Musik ist bekannt für das hohe Niveau, das sie Pianisten abverlangen soll. Wie kein anderer Komponist setzt sie einen besonders weichen Ansatz und Feingefühl voraus – nicht zuletzt deshalb stellt sie bis heute eine große Herausforderung dar. Man könnte meinen, diese Art „Kunstmusik“ gehöre nur in den edlen Konzertsaal einem fein-erlauchten Publikum präsentiert. Und doch ist sein bekanntestes Stück ausgerechnet eines, das nicht nur den Anspruch seiner anderen Kompositionen vermissen lässt, sondern ausgerechnet auch noch für einen zugesprochenen, elitär/ausgrenzenden Charakter bekannt ist. Aber der Reihe nach…
Zum Umstand der Komponierpraxis gehören nicht nur die großen Würfe, sondern auch mal mehr, mal weniger peinliche Anfängerwerke eines jeden späteren Musikgenies. Und wie auch Komponisten einmal klein angefangen haben, so tut es jeder Musiker. Viele namhafte Tonkünstler hinterließen uns deshalb auch Werke, die im Anspruch bewusst niedriger gesetzt waren, um Neulingen den Einstieg in ihr Instrument zu erleichtern.
Man könnte dementsprechend geneigt sein, Chopins Nocturnen, die er im zarten Alter von 20 Jahren komponierte, als eine solche „Anfängerübung“ zu bezeichnen. Insgesamt handelt es sich dabei um 3 Stücke für Solo-Klavier, von denen jedoch die zweite Nocturne in Es am bekanntesten ist. Auch wenn diese Komposition über das Niveau von echten Anfängerübungen hinausgeht – man schaue sich nur die linke Hand an –, so ist die Musik doch leicht nachvollziehbar: Im Wesentlichen haben wir hier eine Melodie, die in variierter Form gespickt mit verkünstelten Koloraturen und zwei Übergangspassagen plus Coda sich selbst vier Mal wiederholt. Ein klassisches, ausgebautes A-B-A-Schema.
Was Chopin hier präsentiert, ist kompositorisch also höchst verspielt, jedoch simpel konstruiert. Die Hauptmelodie setzt er beispielsweise zwar in variierter Form, das Thema aber lässt er nicht durch die Tonarten wandern, sondern übernimmt es in fast schon leitmotivischer Weise. Das ist Einfachheit auf hohem Niveau. Dazu auch eine eingängige Melodie, die sich schon nach dem zweiten Hören derart festigt, dass sie wohl jeder wiedererkennt. Eine Musik also, wie sie auch im Hintergrund zu einer Tasse Earl Grey oder Tee Matcha subtil vor sich hindudeln könnte, ohne ausladenden Anspruch an die Hörenden zu stellen. Ein Glück daher, dass die Komposition keine 5 Minuten lang ist: Liebhaber dürften den beruhigenden Charakter und die harmonische Atmosphäre herausstreichen, Kritiker jedoch eher das Wort „Langeweile“ in den Mund nehmen.
An diesem Punkt möchte ich auch kein Geheimnis daraus machen: Ich mag Chopin nicht. Seine Musik ist mir zu monoton, ruhig und fließend. Zum Runterkommen und Abschalten für ein paar Minuten ist mir das recht, aber nach spätestens einer halben Stunde bin ich davon eingeschlafen. Wenn ich also feststellen muss, dass Musik wie diese sich einer großen Bekanntheit und Beliebtheit erfreut, dann stehe ich da mit einer gewissen Portion Unverständnis vor.
Denn Stücke wie diese Nocturne, die im Konzertsaal vielleicht einmal zur Zugabe präsentiert werden, ansonsten aber wohl eher fortgeschrittenen Anfängern vorbehalten sein dürften, erfahren heutzutage eine fragwürdige Umdeutung inklusive Aufwertung. Nicht anders kann man es begründen, dass ausgerechnet diese Nocturne – schlank, einfach, unaufgeregt – eine breite mediale Verwendung gefunden hat. Und zwar als Ausdruck eines abgehobenen Elitenverständnisses.
Erst 2012 präsentierte Hang Thi Tuyet Nguyen eine Studie zur Verwendung von Chopins Musik in Massenmedien. In dieser Arbeit nannte sie eine Reihe von Tropen, die mit Chopins Musik durch Auswahl in Werbespots in Verbindung gesetzt werden. Und man lese und staune: Zu der simplen Nocturne in Es fallen vor allem die Worte „Ästhetik“, „Konformität“ und „Nostalgie“. Diese Zuordnung kann Hang Thi Tuyet Nguyen auch mit Beispielen belegen. Und da fallen insbesondere auf Hochglanz polierte Werbefilme über Markenmode, Designunterwäsche, Luxusschokolade, Parfum und Waschmittel ins Auge:
Nun lässt sich über die Verwendung klassischer Musik in kommerzieller Vermarktung vieles Schreiben – auch innerhalb dieser Serie ist dies bereits ein oft aufgegriffener Kritikpunkt gewesen. Das Hauptproblem, das dadurch entsteht, ist eine Stigmatisierung. Durch die Auswahl einer Komposition wie der Nocturne in Es geht auch automatisch das Wecken von Assoziationen beim Publikum einher. Angestrebt dürfte in diesem Fall wohl ein Verständnis von Klasse und Luxus für das gezeigte Produkt sein. Musik aber unterstreicht nicht nur die zu ihr gezeigten Bilder – die Richtung der Beeinflussung funktioniert auch umgekehrt.
Dadurch wirkt nicht nur das beworbene Produkt abgehoben und für den normalen Menschen unerreichbar. Sondern auch die Musik, die damit assoziiert wird. Mir geht es mit dieser Nocturne beispielsweise genauso: Wenn sie mich nicht langweilt, dann ekelt sie mich an. Und das alles nur, weil ich sie ein paar Mal zu oft im Fernsehen zu Werbung für Produkte gehört habe, die nicht meiner Lebensrealität entsprechen, sondern mich an das versnobbte, ungezügelte Leben von Multimillionären erinnern.
Der Verlust daran beschränkt sich nicht nur darauf, dass eine einzelne Komposition ihren Reiz verliert. Sondern durch diese Verknüpfung gerät ein ganzes Musikgenre – hier die klassische Musik – in Verruf, Sprachrohr für gesellschaftlich abgehobene Eliten zu sein. Nur zu oft hört und liest man in diesem Kontext, dass man zum Verständnis solcher „echten Musik“ die nötige Reife mitbringen müsse. Dem halte ich die Frage entgegen, ob alles, was heutzutage stattfindet, keine Musik mehr sei. Denn die als „Popmusik“ bezeichneten Werke sind nach nur einem Hören ohne weitere Vorbereitung wirksam. Klassik kann dasselbe – meiner Meinung nach sogar noch eindrucksvoller! Aber eben nur, wenn sie nicht aus dem Kontext gerissen und mit künstlichen Assoziationen versehen wird, wie es heutzutage viel zu oft geschieht. Ich bin jedenfalls überzeugt, dass Chopin nicht an Luxusunterwäsche gedacht hat, als er diese Fingerübung für Klavier konzipierte.
Daniel Janz, 13. August 2021, für
klassik-begeistert.de und klassik-begeistert.at
Ladas Klassikwelt (c) erscheint jeden Montag.
Frau Lange hört zu (c) erscheint jeden zweiten Dienstag.
Schweitzers Klassikwelt (c) erscheint jeden zweiten Dienstag.
Sommereggers Klassikwelt (c) erscheint jeden Mittwoch.
Hauters Hauspost (c) erscheint jeden zweiten Donnerstag.
Radek, knapp (c) erscheint jeden zweiten Donnerstag.
Pathys Stehplatz (c) erscheint jeden zweiten Donnerstag.
Daniels Antiklassiker (c) erscheint jeden Freitag.
Spelzhaus Spezial (c) erscheint jeden zweiten Samstag.
Der Schlauberger (c) erscheint jeden Sonntag.
Ritterbands Klassikwelt (c) erscheint jeden zweiten Sonntag.
Posers Klassikwelt (c) erscheint jeden zweiten Sonntag.
 Daniel Janz, Jahrgang 1987, Autor, Musikkritiker und Komponist, studiert Musikwissenschaft im Master. Klassische Musik war schon früh wichtig für den Sohn eines Berliner Organisten und einer niederländischen Pianistin. Trotz Klavierunterricht inklusive Eigenkompositionen entschied er sich gegen eine Musikerkarriere und begann ein Studium der Nanotechnologie, später Chemie, bis es ihn schließlich zur Musikwissenschaft zog. Begleitet von privatem Kompositionsunterricht schrieb er 2020 seinen Bachelor über Heldenfiguren bei Richard Strauss. Seitdem forscht er zum Thema Musik und Emotionen und setzt sich als Studienganggutachter aktiv für Lehrangebot und -qualität ein. Seine erste Musikkritik verfasste er 2017 für Klassik-begeistert. Mit Fokus auf Köln kann er inzwischen auch auf musikjournalistische Arbeit in Österreich, Russland und den Niederlanden sowie Studienarbeiten und Orchesteraufenthalte in Belgien zurückblicken. Seinen Vorbildern Strauss und Mahler folgend fragt er am liebsten, wann Musik ihre angestrebte Wirkung und einen klaren Ausdruck erzielt.
Daniel Janz, Jahrgang 1987, Autor, Musikkritiker und Komponist, studiert Musikwissenschaft im Master. Klassische Musik war schon früh wichtig für den Sohn eines Berliner Organisten und einer niederländischen Pianistin. Trotz Klavierunterricht inklusive Eigenkompositionen entschied er sich gegen eine Musikerkarriere und begann ein Studium der Nanotechnologie, später Chemie, bis es ihn schließlich zur Musikwissenschaft zog. Begleitet von privatem Kompositionsunterricht schrieb er 2020 seinen Bachelor über Heldenfiguren bei Richard Strauss. Seitdem forscht er zum Thema Musik und Emotionen und setzt sich als Studienganggutachter aktiv für Lehrangebot und -qualität ein. Seine erste Musikkritik verfasste er 2017 für Klassik-begeistert. Mit Fokus auf Köln kann er inzwischen auch auf musikjournalistische Arbeit in Österreich, Russland und den Niederlanden sowie Studienarbeiten und Orchesteraufenthalte in Belgien zurückblicken. Seinen Vorbildern Strauss und Mahler folgend fragt er am liebsten, wann Musik ihre angestrebte Wirkung und einen klaren Ausdruck erzielt.
Daniels Anti-Klassiker 23: Jacques Offenbach – „Cancan“ aus „Orpheus in der Unterwelt“ (1858)