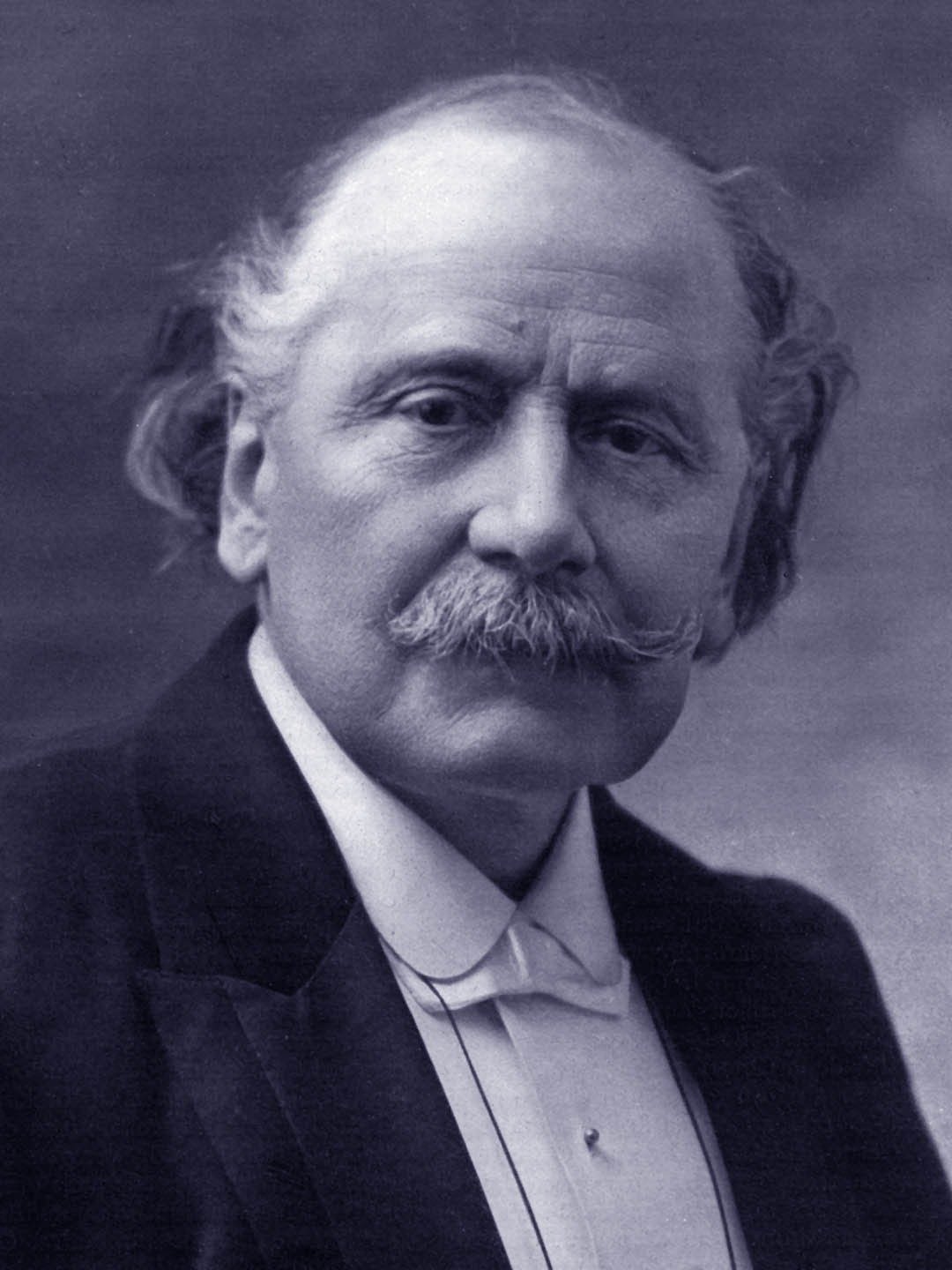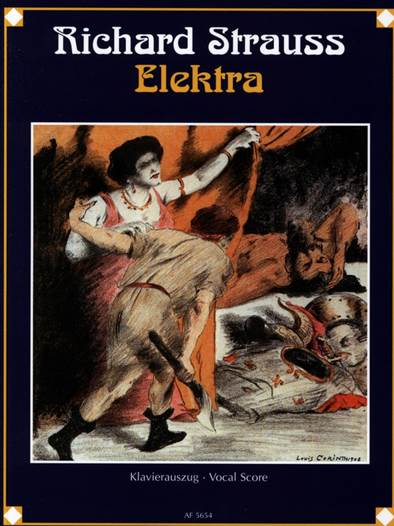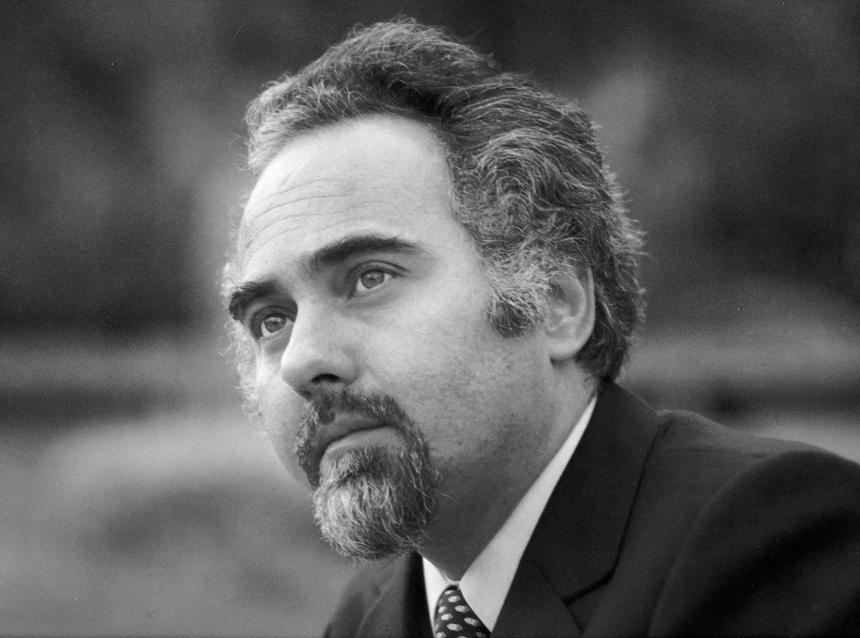Sophie Dervaux—Felix Mendelssohn Bartholdy Op.109—Lieder ohne Worte (2017)
von Dr. Lorenz Kerscher
Die 1991 in Paris geborene Sophie Dervaux ist Tochter eines Mathematikers und Ingenieurs und einer Gitarrenlehrerin. So überrascht es nicht, dass sie zunächst das Instrument ihrer Mutter erlernte. Ihr Wunsch war jedoch, in Gemeinschaft zu musizieren, wofür sich ein Blasinstrument anbot. Das war zunächst die Klarinette, bis ihr diese offenbar zu klein wurde und sie 2003 auf das Fagott wechselte. Doch auch dessen zweieinhalb Meter Rohrlänge waren noch lange nicht das Ende der Fahnenstange, wurde sie doch schon 2013 als Solokontrafagottistin der Berliner Philharmoniker verpflichtet. Sie fand jedoch bald wieder zum Normalmaß zurück und ist seit 2015 Solofagottistin der Wiener Philharmoniker.
So ungewöhnlich es auch ist, schon in so jungen Jahren Solostellen in den vielleicht renommiertesten Orchestern der Welt zu besetzen, würde ich eine Künstlerin deshalb nicht als Rising Star vorstellen. Von Interesse ist dafür vor allem ihr Wirken als Solistin, die ihrem eher unter „ferner liefen“ firmierenden Instrument alle Ehre macht. „Mit ihrem Album impressions hebt sie das Fagott in den Adelsstand“, befand eine auf ihrer Homepage zitierte Kritikerstimme. Die positive Bewertung ihres Debütalbums war auch für die gerade 30-Jährige ein Ritterschlag und die Wertschätzung für eine Individualität des künstlerischen Ausdrucks, die im Orchesterdienst so nicht in Erscheinung treten konnte.
Sophie Dervaux – Sonata, op. 168: II. Allegretto scherzando – Saint-Saëns (2021)
Schon während ihres Studiums am Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon in den Jahren 2008 bis 2011 nahm sie an Wettbewerben teil und erzielte damals noch unter ihrem Geburtsnamen Sophie Dartigalongue wichtige Preise. 2011 setzte sie dann als Stipendiatin an die Orchester-Akademie der Berliner Philharmoniker ihre Ausbildung fort und erzielte 2013 beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD einen zweiten Preis und Publikumspreis. Ein erster Preis wurde damals nicht vergeben und niemand weiß, welches gewisse Etwas die Jury noch vermisst hatte. Die Berliner Philharmoniker hatten jedenfalls keine Vorbehalte, sie als Kontrafagottistin zu engagieren, mussten sie jedoch schon zwei Jahre später zu den Wiener Philharmonikern gehen lassen. „Rising Stars 28: Sophie Dervaux, Fagott
klassik-begeistert.de“ weiterlesen