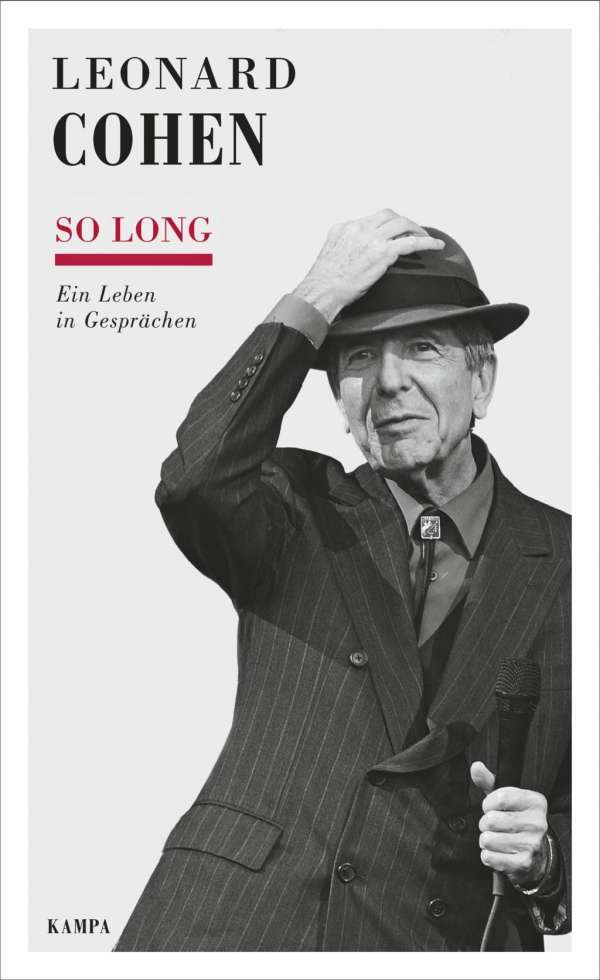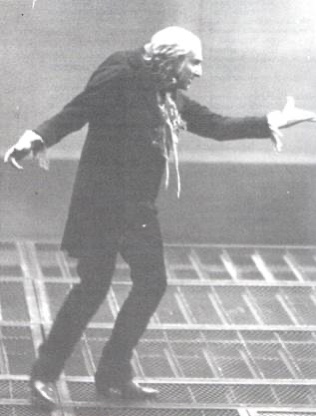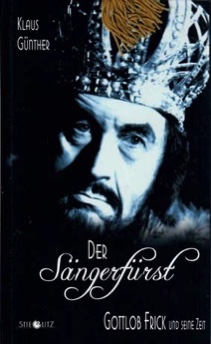Dr. med. Birgit Meyer, Foto © Paul Leclaire
Wie ein Lauffeuer geht es durch die Medien, dass wir von der Kölner Intendantin bald Abschied nehmen müssen. Als naive Outsider aus Wien dazu einige Gedanken.
von Lothar und Sylvia Schweitzer
Prinzipiell stellt sich die Frage, wie lange die Intendanz einer anerkannten Persönlichkeit währen soll. Entgegen der Wiener konservativen Mentalität und dadurch sicher ins Kreuzfeuer der Kritik geratend ist unsre Meinung zwei bis drei ordentliche Vertragsperioden (je vier bis fünf Spielzeiten), auf keinen Fall viel länger als insgesamt fünfzehn Jahre, denn die Theater- und Opernliebhaber sollen im Laufe ihres kulturinteressierten Lebens mehrere „Handschriften“ kennen lernen. Jeder mit Sorgfalt ausgewählte Intendant oder Direktor hat seine besonderen Fähigkeiten und Talente und setzt andere Akzente, mit denen er der hoffentlich immerwährenden, „ewigen“ Institution des jeweiligen Theaters dienen kann. Keine Regel ohne Ausnahme: Uns störte die fünfundzwanzigjährige Intendanz von Helmut Wlasak am Tiroler Landestheater keinesfalls. „Schweitzers Klassikwelt 31: Eine Lanze brechen für Dr. Birgit Meyer, Intendantin der Oper Köln“ weiterlesen



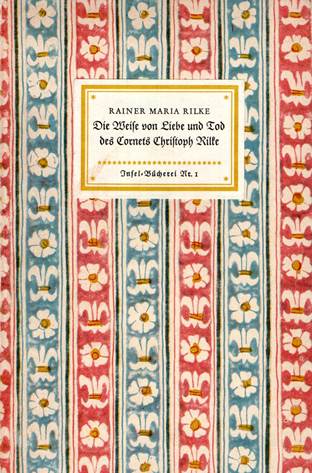

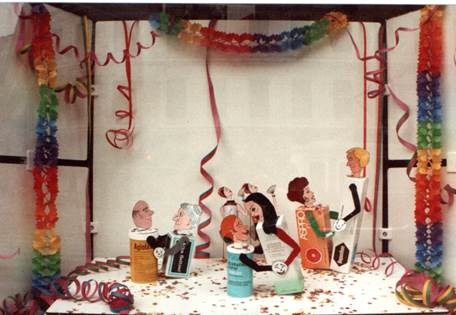
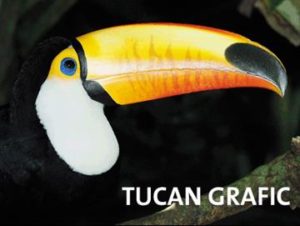 Über die Arrangements seitens der pharmazeutischen Firmen nicht glücklich begannen meine Frau und ich die Auslagen unsrer Apotheke selbst zu gestalten, wobei wir „Regie“ führten, das „Bühnenbild“ am Anfang von einem Grafikstudenten, später von der Firma Tucan Grafic im 3. Wiener Gemeindebezirk hergestellt wurde. Zusätzlich gehörte zu unserem Team ein Model. Thema und Idee lieferten meine Frau und ich, bezüglich der Ausführung entstand ein reger Gedankenaustausch zwischen dem Studenten bzw. dem Grafikbüro und uns, so dass wie im Theaterleben schlussendlich zwischen Regie und Bild die Grenzen verschwammen.
Über die Arrangements seitens der pharmazeutischen Firmen nicht glücklich begannen meine Frau und ich die Auslagen unsrer Apotheke selbst zu gestalten, wobei wir „Regie“ führten, das „Bühnenbild“ am Anfang von einem Grafikstudenten, später von der Firma Tucan Grafic im 3. Wiener Gemeindebezirk hergestellt wurde. Zusätzlich gehörte zu unserem Team ein Model. Thema und Idee lieferten meine Frau und ich, bezüglich der Ausführung entstand ein reger Gedankenaustausch zwischen dem Studenten bzw. dem Grafikbüro und uns, so dass wie im Theaterleben schlussendlich zwischen Regie und Bild die Grenzen verschwammen.