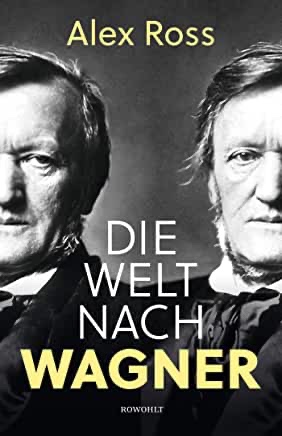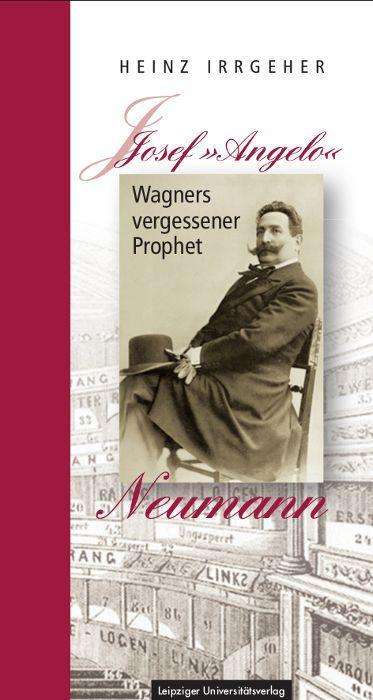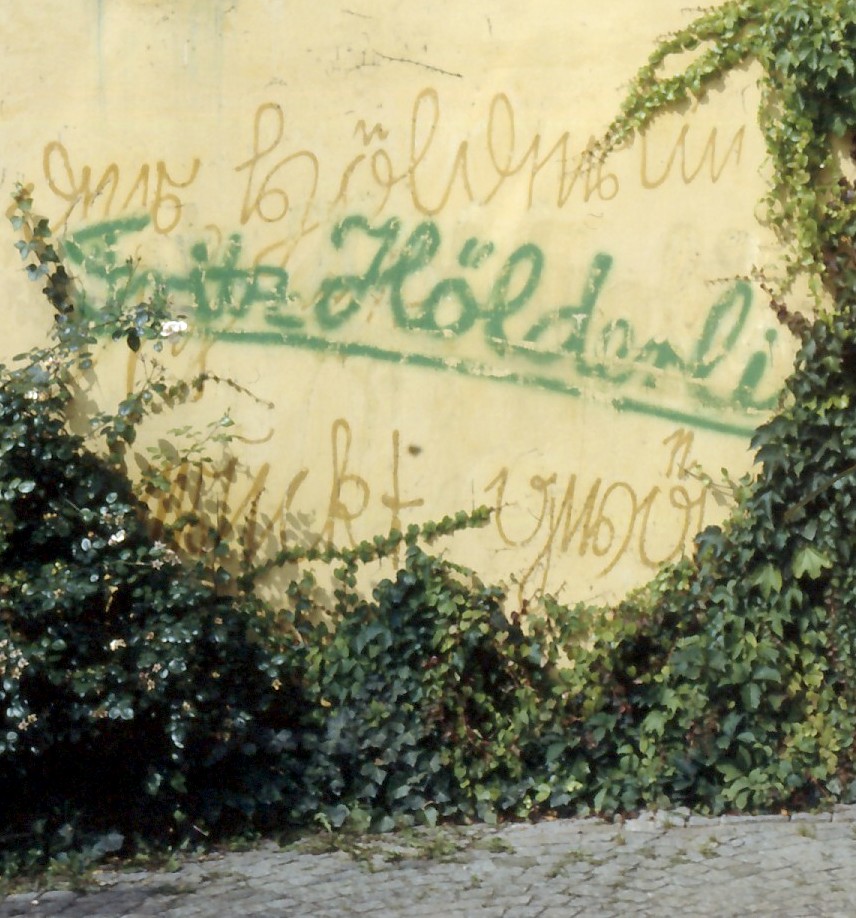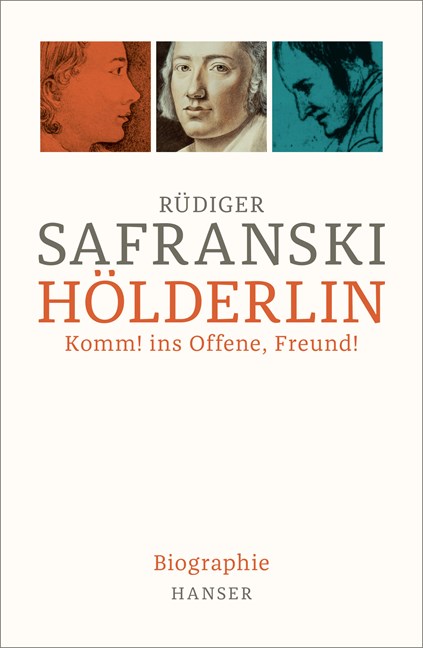Man würde sich wünschen, dass das Buch den Weg in die Hände aller Opernintendanten und Dramaturgen findet und sie animiert, den allzu eng gewordenen Kanon der regelmäßig aufgeführten Opern aufzubrechen.
Buch-Rezension
Bernd Feuchtner: Die Oper des 20. Jahrhunderts
in 100 Meisterwerken
Wolke-Verlag
von Peter Sommeregger
Es spricht für die Klugheit des Autors, ein Buch über die Oper des 20.Jahrhunderts auf eine Auswahl von hundert Werken zu begrenzen. Dies geschieht sehr zum Nutzen des nun vorgelegten Bandes, der trotz dieser weisen Beschränkung ein in jeder Hinsicht gewichtiges Buch geworden ist.
Es liegt im Wesen einer selektiven Darstellung, dass der eine oder andere Leser ein ihm besonders wichtiges Werk aus diesen hundert Jahren vermissen wird. Ein genauer Blick auf die Liste der behandelten Opern zeigt aber, wie sorgfältig und klug Bernd Feuchtner seine Auswahl getroffen hat. Vielfach wählte er weniger bekannte oder erfolgreiche Werke eines Komponisten, Auswahlkriterium war wohl in erster Linie die Originalität des Werkes. Feuchtner ist ein Mann der Praxis, als Musikkritiker und später auch Operndirektor bringt er praktische Erfahrung mit, sein umfassendes Wissen macht dieses Buch nicht nur zu einer interessanten Lektüre, es fesselt auch durch seinen Detailreichtum. „Buch-Rezension, Bernd Feuchtner: Die Oper des 20. Jahrhunderts in 100 Meisterwerken
klassik-begeistert.de“ weiterlesen