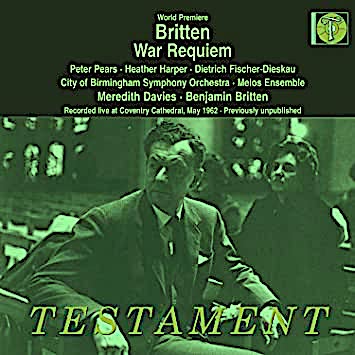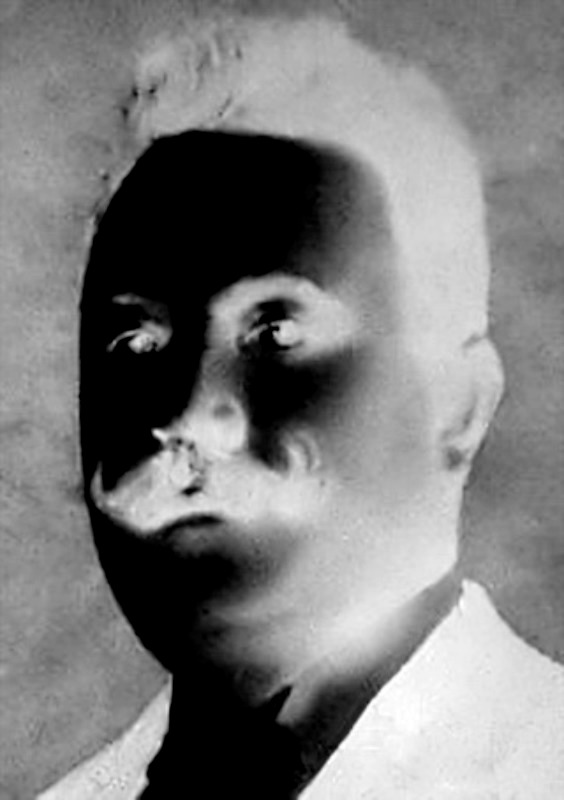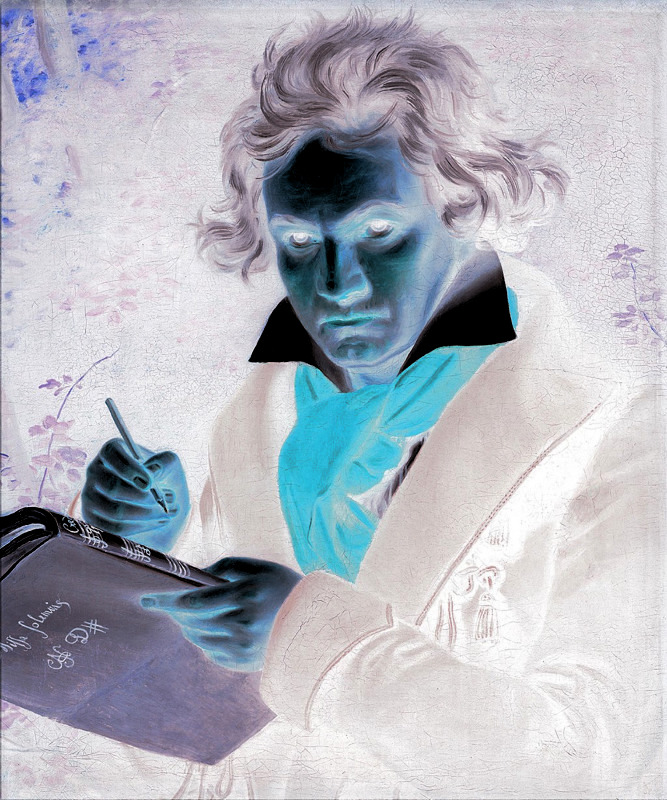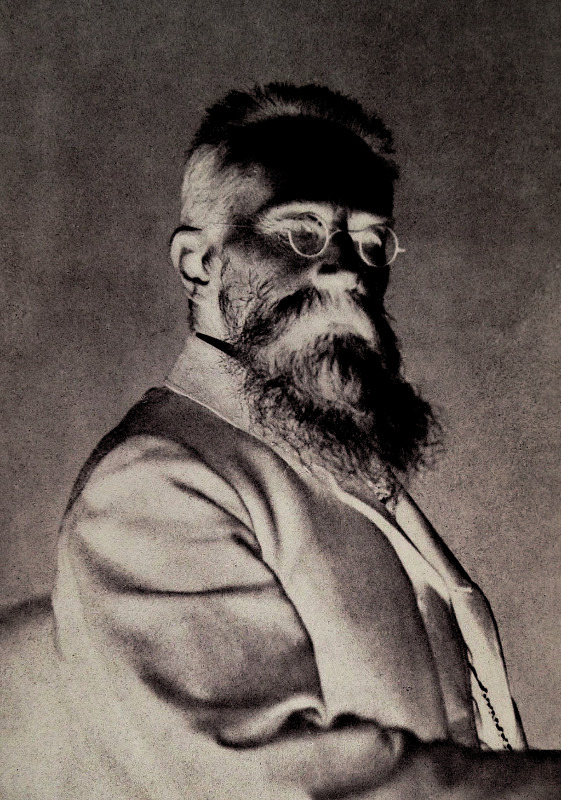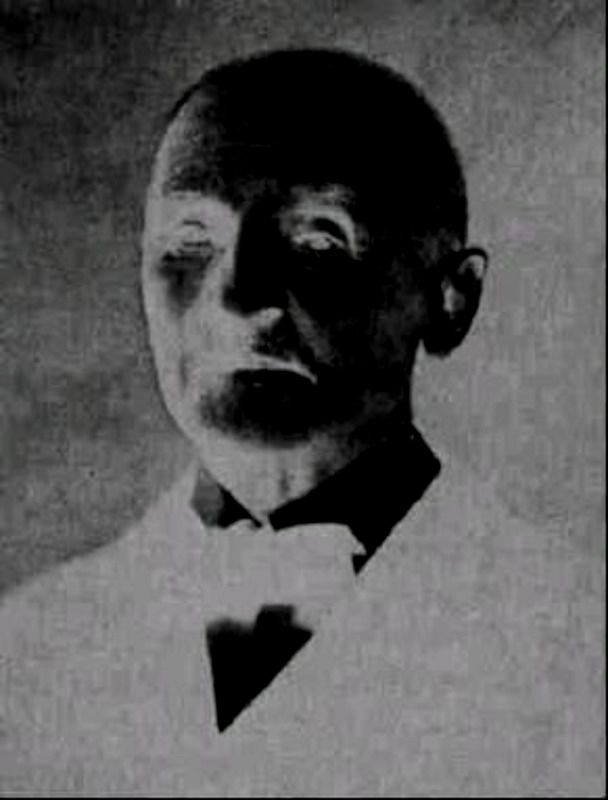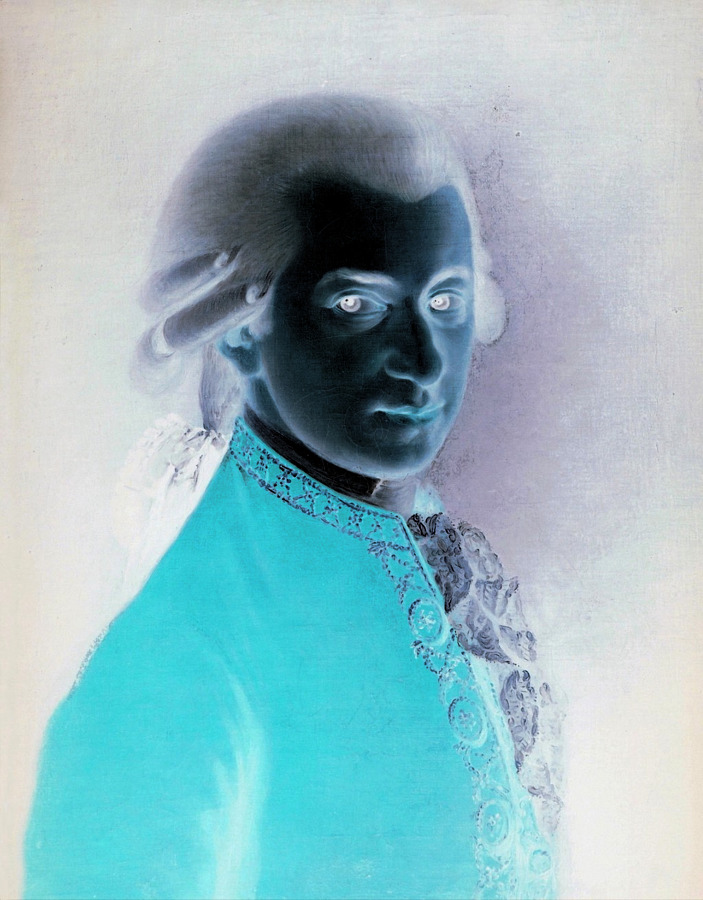Höchste Zeit sich als Musikliebhaber einmal neu mit der eigenen CD-Sammlung oder der Streaming-Playlist auseinanderzusetzen.
Dabei begegnen einem nicht nur neue oder alte Lieblinge. Einige der so genannten „Klassiker“ kriegt man so oft zu hören, dass sie zu nerven beginnen. Andere haben völlig zu Unrecht den Ruf eines „Meisterwerks“. Es sind natürlich nicht minderwertige Werke, von denen man so übersättigt wird. Diese teilweise sarkastische, teilweise brutal ehrliche Anti-Serie ist jenen Werken gewidmet, die aus Sicht unseres Autors zu viel Beachtung erhalten.
von Daniel Janz
Einschneidende Erlebnisse in der Menschheitsgeschichte hinterlassen oft auch ihre Spuren in Kulturen und damit der Musik. Als solches ist auch der Bereich der Orchesterkompositionen voll mit Werken, die sich auf Katastrophen, menschliche Dramen und Kriege beziehen. Meistens wird damit auch eine besondere Bedeutung verbunden – eine herausragende Stellung, die oft synonym mit Qualität gesetzt wird. Dass dies nicht automatisch immer einhergehen muss, soll heute an einem Beispiel diskutiert werden, das ab und an sogar als Ursprung für ein ganzes Genre bezeichnet wird: Die Rede ist von Benjamin Brittens „War Requiem“.
Über Kriege zu berichten ist immer eine undankbare Aufgabe, insbesondere wenn man als Betroffener davon erzählt. Nicht nur die Erfahrungen, die man in solchen Kontexten machen muss, reichen, um für ein ganzes Leben zu traumatisieren. Auch die Zerstörung, all das Leid und den Terror des Kriegs wiederzugeben, verlangt alles Menschenmögliche ab. Es verwundert daher nicht, dass es zahlreiche Beispiele dafür gibt, dass Menschen statt der Aussprache das Schweigen suchen und die gemachten Erfahrungen mit sich sterben lassen. „Daniels Anti – Klassiker 39: Benjamin Britten – War Requiem (1962),
klassik-begeistert.de“ weiterlesen