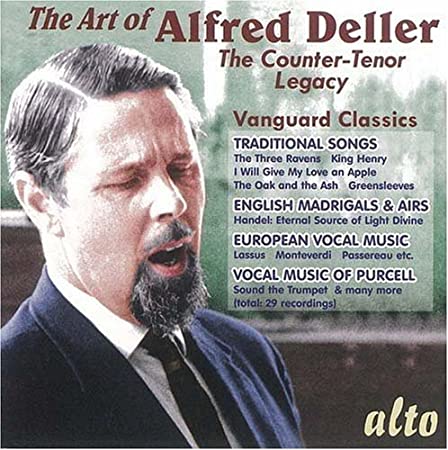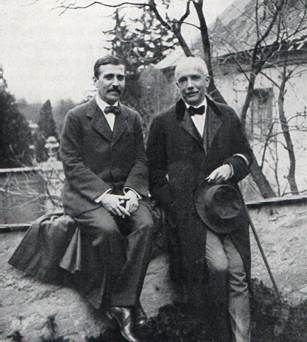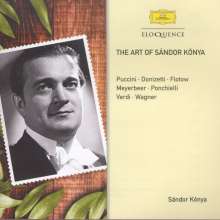Tritt den Sprachpanschern ordentlich auf die Füße! Gern auch unordentlich. Der Journalist und Sprachpurist Reinhard Berger wird unsere Kultur nicht retten, aber er hat einen Mordsspaß daran, „Wichtigtuer und Langweiler und Modesklaven vorzuführen“. Seine satirische Kolumne hat er „Der Schlauberger“ genannt.
Eine Mini-Serie über Missverständnisse
von Reinhard Berger
Ob Sie’s glauben oder nicht: Das gibt es wirklich! Und zwar fünfmal: zweimal in Mecklenburg-Vorpommern und je einmal in Brandenburg, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Schabernack.
Ganz ehrlich: Da möchte ich nicht unbedingt leben. Dauernd diese Rechtfertigung bei der Ortsangabe.
Omas Rippe ist kein Schabernack. Gut gefüllt, wird sie für 4,99 Euro das Kilo verkauft. Manchmal stammt sie auch vom Schwein. Die Rippe. Und ist mit Äpfeln vollgestopft. Muss ganz schön dick sein, der alte Knochen. Also der vom Schwein. Nun, so ’ne Handvoll Äpfel hat ja allerhand Volumen.
Dieses Schabernack ist ein Ortsteil der Stadt Garz auf Rügen.
Oma? Oder Schwein? Was denn nun?
Reinhard Berger, 12. Juni 2022, für
klassik-begeistert.de und klassik-begeistert.at
Zuerst erschienen in: HNA
Der Schlauberger (c) erscheint am Sonntag.

Reinhard Berger
Allerleikeiten: Reinhard Berger, geboren 1951 in Kassel, Journalist, Buchautor, Hunde- und Hirnbesitzer.
Vergänglichkeiten: Vor dem Ruhestand leitender Redakteur der Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen (HNA).
Herzlichkeiten: verheiratet, zwei Söhne, zwei Schwiegertöchter, drei Enkel, ein Rottweiler.
Anhänglichkeiten: Bach, Beethoven, Bergers Nanne (Ehefrau).
Auffälligkeiten: Vorliebe für Loriot, Nietzsche, Fußball, Steinwayflügel, Harley-Davidson.
Öffentlichkeiten: Schlauberger-Satireshow, Kleinkunstbühne.
Alltäglichkeiten: Lebt auf einem ehemaligen Bauernhof.
www.facebook.com/derschlauberger