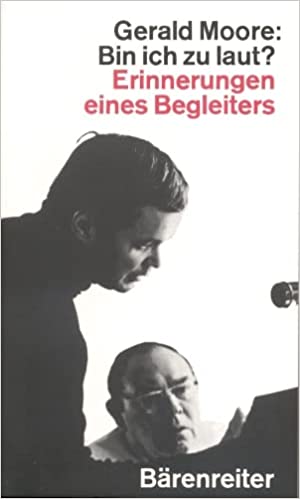In diesen Tagen kann die Opernwelt des 50. Todestages von Lauritz Melchior gedenken. Er starb 1973 in Santa Monica in seiner kalifornischen Wahlheimat.
von Peter Sommeregger
Geboren und aufgewachsen ist der Sänger in Kopenhagen, wo er auch mit 18 Jahren seinen ersten Gesangsunterricht erhielt. Sein Lehrer betrachtete Melchiors Stimme als Bariton und bildete ihn als solchen aus. 1913 debütierte er am Königlichen Theater seiner Heimatstadt, wo er anschließend für einige Jahre Bariton- und sogar Basspartien der zweiten Garnitur sang. Erfahrene Kollegen wiesen ihn darauf hin, dass seine Stimme viel eher ein Tenor, ja sogar ein Heldentenor war. Daraufhin studierte er neu und hatte sein Debüt als Tenor in einer Tannhäuser-Aufführung 1918 in Kopenhagen. „Sommereggers Klassikwelt 178: „Tristanissimo“ Lauritz Melchior
klassik-begeistert.de, 22. März 2023“ weiterlesen