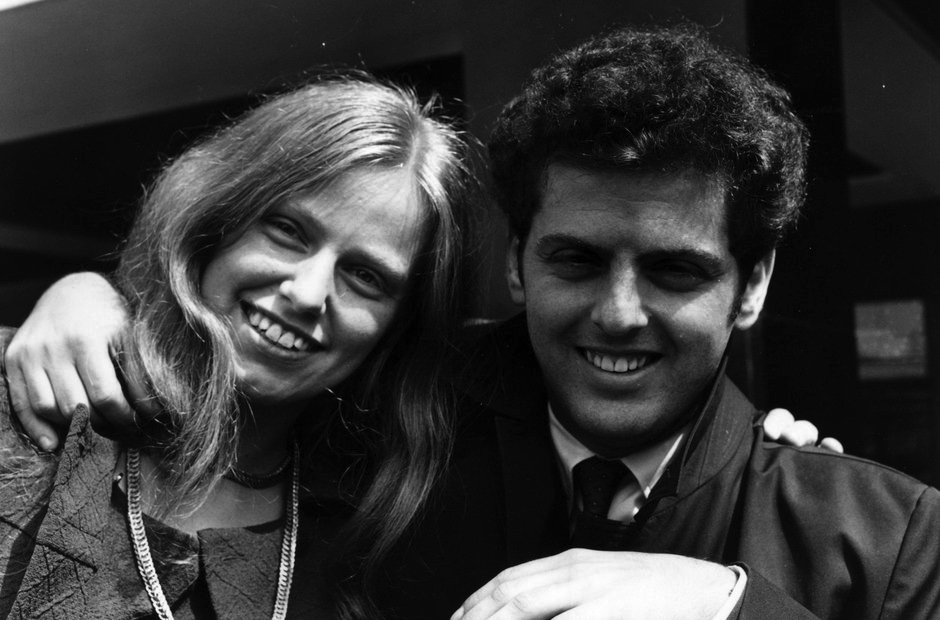Klassik vom Feinsten: Die 25 meistgelesenen Beiträge auf Klassik begeistert (11)
3600 Beiträge haben wir als größter Klassik-Blog in Deutschland, Österreich und der Schweiz (google-Ranking) in den vergangenen viereinhalb Jahren veröffentlicht. Jetzt präsentieren wir die 25 meistgelesenen Opern- und Konzertberichte, Interviews, Klassikwelten und Rezensionen – jene Beiträge, die Sie seit Juni 2016 am häufigsten angeklickt haben. Wir wünschen viel Freude beim „Nachblättern“.
11 – Die Avantgarde-Industrial-Band „Laibach“ spielt in Nordkorea
Bild: Album artwork by Valnoir
Wir leben in einer Zeit, in der Dystopien Realität werden. Nicht nur was die Pandemie betrifft, auf die uns etwa Stephen King, Michael Crichton und Terry Gilliam vorbereitet haben. Vor dem, was in den USA, Brasilien, Ungarn, der Türkei … geschieht, haben uns George Orwell oder Margaret Atwood gewarnt. „Laibach“ liefert bereits seit vier Jahrzehnten dafür den Soundtrack.
von Gabriele Lange
„All art is subject to political manipulation (…),
except for that which speaks the language of this same manipulation.“
Laibach, „Manifest”
Eines der faszinierendsten Konzerte meines Lebens war Laibach „The Sound of Music“. Eine Avantgarde-Industrial-Band spielte Songs aus dem zuckersüßen Musical von Rodgers & Hammerstein. Und präsentierte damit eine irritierende Schnittmenge aus Hollywoodunterhaltung, Heimatkitsch und totalitärer Propaganda. Klingt seltsam? Es wird noch bizarrer. Jahre bevor das Album herauskam hatte Laibach ebendiese Songs in Nordkorea gespielt. 2015, zum 70. Jubiläum der Befreiung von der japanischen Besatzung. Mitten im Konflikt um die nukleare Aufrüstung Nordkoreas. Als erste ausländische Rockband, die dort überhaupt je auftreten durfte. Es gibt einen Dokumentarfilm darüber (Liberation Day).
Das hätte schiefgehen können, denn diese Diktatur ist unerbittlich. Auch gegen Ausländer. Damit sich ermessen lässt, was für ein irrwitziges Kunststück Laibach da gelungen ist – und wie das klappen konnte –, muss ich etwas ausholen. „Klassik vom Feinsten: Die 25 meistgelesenen Beiträge auf Klassik begeistert (11)“ weiterlesen