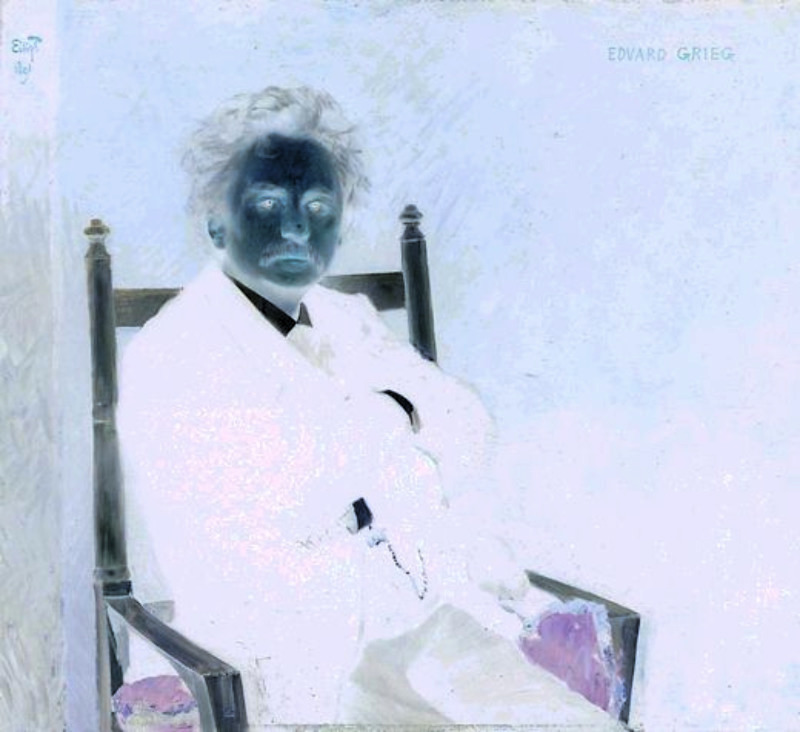Unter Otto Klemperer spielte Christa Ludwig mit Fritz Wunderlich das „Lied von der Erde“ ein, eine Aufnahme, für die allein sich schon die Erfindung der Schallplatte gelohnt hätte.
von Peter Sommeregger
Mit Superlativen sollte man sparsam umgehen, aber wenn es eine Sängerin gibt, die gleich mehrere von ihnen verdient, so ist es Christa Ludwig. Bandbreite, Dauer und Qualität ihrer etwa fünfzigjährigen Karriere konnten und können wohl schwerlich jemals übertroffen werden, das Holz, aus dem man solche Ausnahmekünstler schnitzt, wächst nicht mehr nach.
Für Christa Ludwig war der Weg auf die Bühne bereits durch die Eltern vorgezeichnet, ihre Mutter Eugenie Besalla war selbst erfolgreiche Sängerin und blieb die zeitlebens einzige Gesangslehrerin ihrer Tochter. Schon früh holte Karl Böhm sie an die Wiener Staatsoper, die trotz ihrer Erfolge auch an anderen Häusern ihre künstlerische Heimat blieb. Als Stehplatzbesucher der Sechzigerjahre hatte ich ausgiebig Gelegenheit, Christa Ludwig in einem breiten Rollenspektrum zu erleben. Besonders spannend war es, wenn sie die Fachgrenzen ihres Mezzosoprans zu sprengen versuchte, aber ihre künstlerische Klugheit, vielleicht auch der Rat ihrer erfahrenen Mutter hielt sie von allzu gefährlichen Experimenten ab. „Sommereggers Klassikwelt 85: Christa Ludwig – die Königin ist tot
klassik-begeistert.de“ weiterlesen

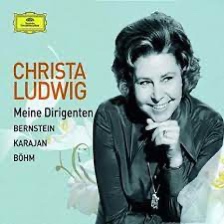


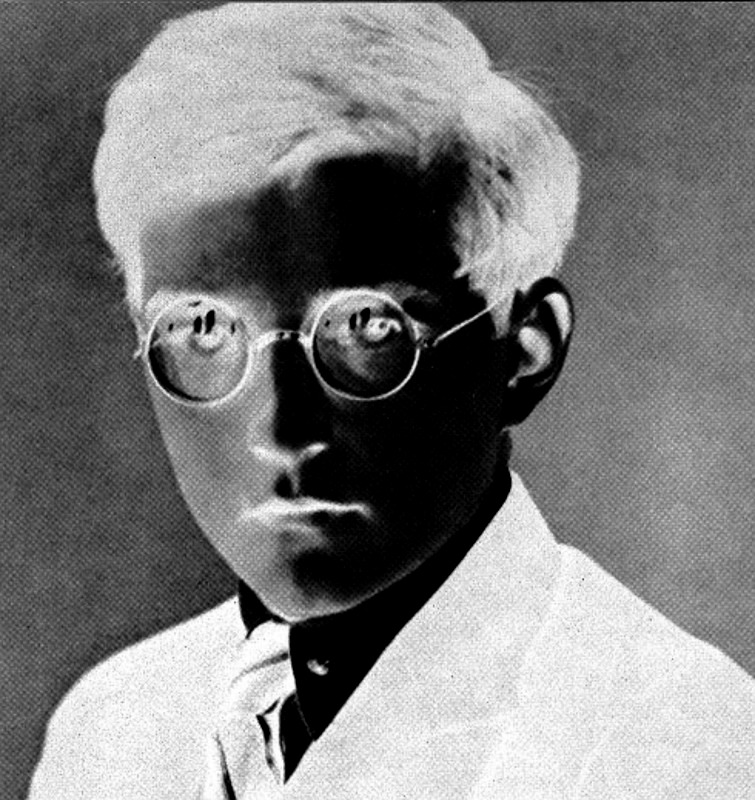

 Anlass dieses Aufsatzes ist die „Elektra“ von Richard Strauss der Salzburger Festspiele 2020. Vielerorts wurde von einer Banalisierung des Atridendramas geschrieben. Doch können uns die „Getriebenen“ auf Kothurnen und im archaischen Gewand menschlich nahe kommen? Die Verlegung der Tragödie vom frühgeschichtlichen, mythisch gefärbten Mykene nach dem New England der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geschah bereits vor fast hundert Jahren in Eugene O’Neills Dramen-Trilogie „Mourning Becomes Elektra“ („Trauer muss Elektra tragen“), knapp nach dem Zweiten Weltkrieg als Film adaptiert und als Oper des heute fast unbekannten Komponisten Marvin David Levy anlässlich der neueröffneten MET am Lincoln Center 1967 wiederum auf die Bühne gekommen.
Anlass dieses Aufsatzes ist die „Elektra“ von Richard Strauss der Salzburger Festspiele 2020. Vielerorts wurde von einer Banalisierung des Atridendramas geschrieben. Doch können uns die „Getriebenen“ auf Kothurnen und im archaischen Gewand menschlich nahe kommen? Die Verlegung der Tragödie vom frühgeschichtlichen, mythisch gefärbten Mykene nach dem New England der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geschah bereits vor fast hundert Jahren in Eugene O’Neills Dramen-Trilogie „Mourning Becomes Elektra“ („Trauer muss Elektra tragen“), knapp nach dem Zweiten Weltkrieg als Film adaptiert und als Oper des heute fast unbekannten Komponisten Marvin David Levy anlässlich der neueröffneten MET am Lincoln Center 1967 wiederum auf die Bühne gekommen.