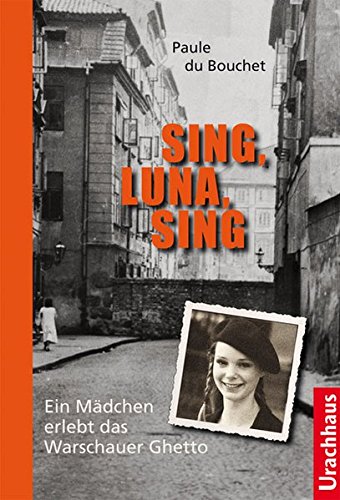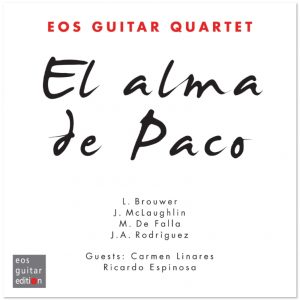Foto: Alexander Arlt, Kronau, FSB
von Jolanta Łada-Zielke
Wenn ich Krakau besuche, erzähle ich befreundeten Dirigenten von meinem Singen im Chor. Sie sagen oft, dass sie mich beneiden, weil deutsche Chöre eine sehr reiche Tradition haben. Also habe ich beschlossen, diese Tradition besser kennenzulernen.
Mit großer Freude habe ich den Ort entdeckt, an dem die Geschichte deutscher Gesangvereine dokumentiert ist: das Sängermuseum, das mit Archiv und Forschungszentrum des Deutschen Chorwesens an der Universität Würzburg in Feuchtwangen in Mittelfranken beheimatet ist. Ich bin dorthin gekommen, um mit dem Archiv- und Museumsleiter Alexander Arlt zu sprechen, der auch selbst Chorleiter ist.

„Das Sängermuseum in Feuchtwangen gründete man im Jahr 1989“, erzählt Alexander Arlt. „Davor gab es das Deutsche Sängermuseum im ehemaligen Katharinenkloster in Nürnberg, das 1925 eingeweiht, aber während des Zweiten Krieges (im Januar 1945) nahezu vollständig zerstört worden ist. Von dieser Zeit zeugen einige Bilder, anhand deren man sich einen ersten Eindruck von der Ausstellung machen kann. Der Deutsche Sängerbund nutzte damals auch die Klosterkirche. Dort waren nicht nur das Gefallenendenkmal des deutschen Sängerbundes und das des Deutschen Arbeiter-Sängerbundes zu finden, auch fanden dort regelmäßig Chorkonzerte statt. Ein wichtiger Bestandteil der Ausstellung waren Vereins-und Verbandfahnen, wie das Bundesbanner des Deutschen Sängerbundes, das gleich im Foyer des Museum die Besucher begrüßte. Zum Glück überstand die Fahne den Zweiten Weltkrieg nahezu unbeschadet im Depot des Germanischen Nationalmuseums. Gleiches gilt für die Fahne des Deutschen Sängerfestes in Nürnberg 1861, die heute zu unseren wertvollsten Exponaten gehört.“
Ich schaue mir diese beeindruckende Fahne in der Vitrine an.
„Also doch Nürnberg! – sage ich mit Begeisterung. – Dort fing das alles an, und es gab zweifellos eine Verbindung zu den Meistersingern.“
„Im Deutschen Sängerbund hat man sich tatsächlich immer wieder auf die Meistersinger berufen“, antwortet Alexander. „Man ging sogar noch bis zu den Minnesängern zurück. Natürlich gibt es Gemeinsamkeiten, die sind aber nicht eins zu eins auf die Laienchorbewegung zu übertragen. So war auch die Katharinenkirche in Nürnberg der Treffpunkt der Meistersinger bis zu ihrer Auflösung. Deswegen nennt man sie auch „die Meistersinger-Kirche“. Das mag auch ein Grund gewesen sein, weswegen man die ehemalige Klosteranlage für geeignet hielt, dort das Deutsche Sängermuseum mit einem Sängerarchiv einzurichten.
So erfahre ich von dem Deutschen Sängerbund, der 1862 als ein Dachverband der deutschen Laienchöre gegründet wurde. Später gab es auch den Deutschen Arbeiter-Sängerbund, der die gleiche Funktion für die Arbeiterchöre erfüllte.

Den ersten als Verein organisierten Gesangsverein gründete Carl Friedrich Zelter (1758-1832) im Jahr 1809 in Berlin, die so genannte Zeltersche Liedertafel. Es existierten außerhalb der Kirche schon damals weitere Chöre und andere singende Gemeinschaften. Bei ihnen lässt sich bisweilen eine richtige Vereinsstruktur – aber nur im Ansatz – nachweisen. „Die Geschichte der Gesangvereine in Deutschland – Teil 1.
“ weiterlesen