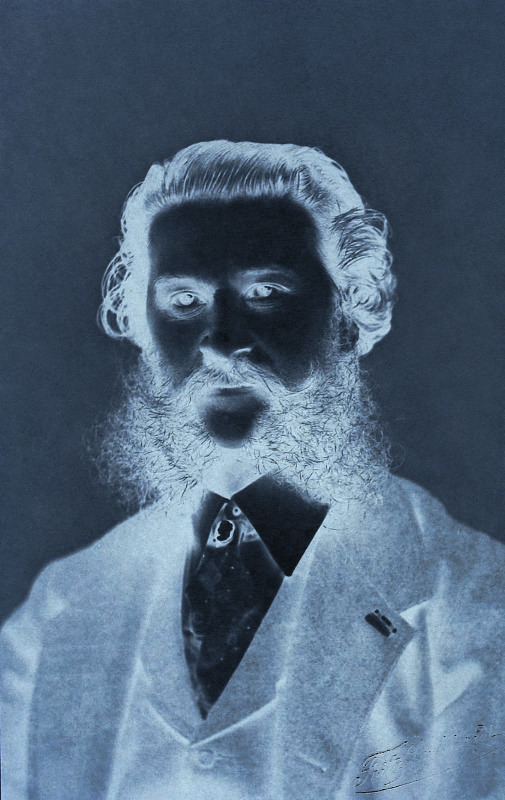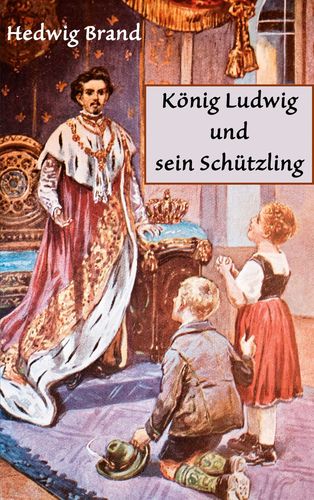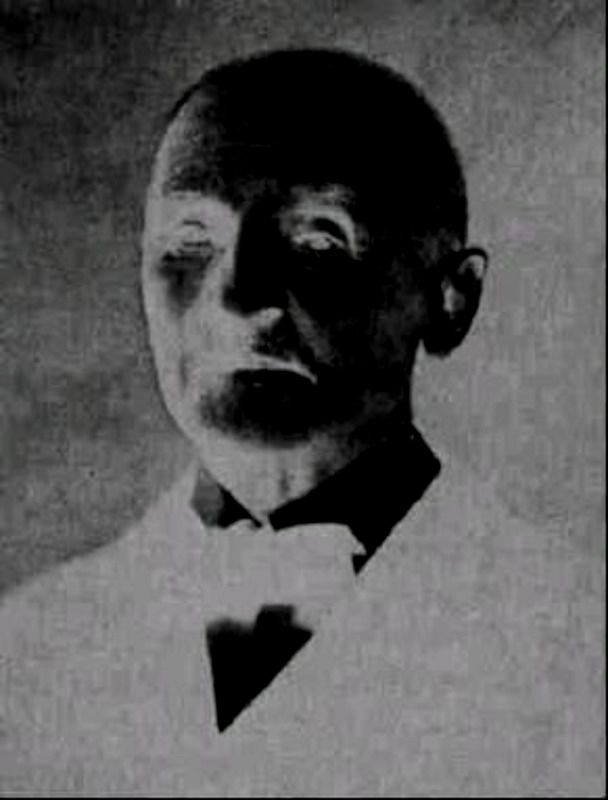Jolanta Łada-Zielke
Diese Pflanze ist sehr verbreitet, vor allem in der Küche als Gewürz. Aufgrund seines angenehmen Geruchs verwendet man sie auch häufig als Bestandteil zur Herstellung von Seife. In der europäischen Kultur, schon seit antiken Zeiten, hatte der Rosmarin eine sehr umfangreiche Symbolik, sowohl mit Liebe als auch mit Tod verbunden.
Mädchen machten daraus Hochzeitskränze und Sträuße, die sie am Trauungstag dem Bräutigam überreichten. Die Beispiele hierfür finden sich in der Literatur, im Schaffen der Troubadoure, oder in Shakespeares „Hamlet“, wobei Ophelia dem Titelhelden einen Rosmarinkranz als Zeichen ihrer Treue band. Schon in der Antike legte man die Rosmarinzweige in die Hände der Verstorbenen während der Beerdigung. Man glaubte, dass auf diese Weise ihre Reise in das Land des ewigen Glücks angenehmer sein würde. „Ladas Klassikwelt 73, Der Rosmarin