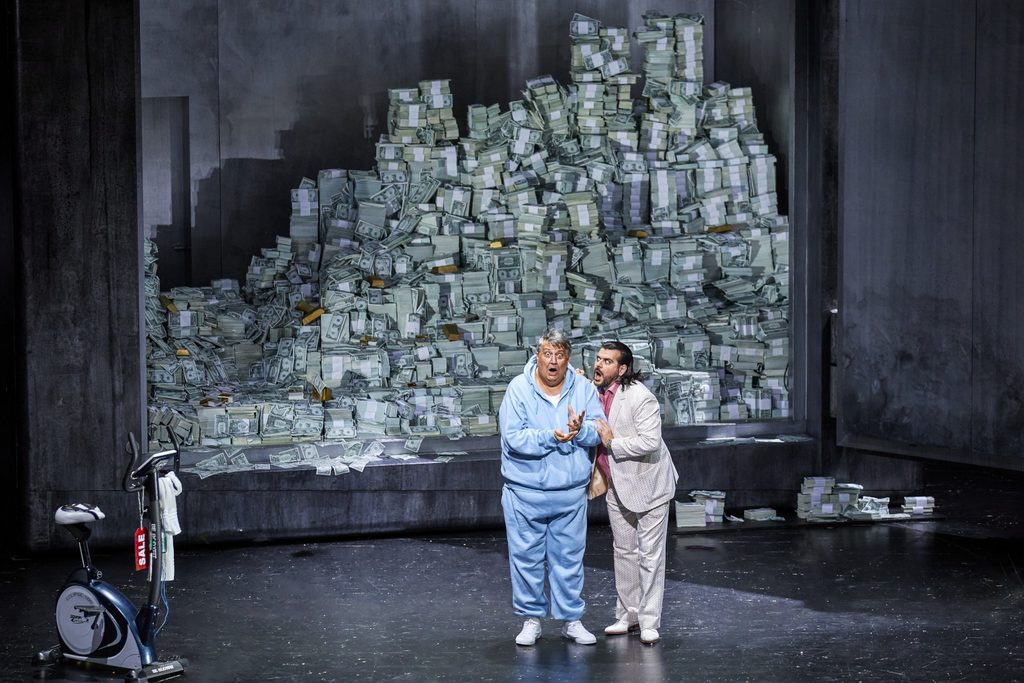Fotos © 2022 Brinkhoff/Mögenburg
Es könnte ja so einfach sein. Don Pasquale, ausstaffiert als alter reicher Sack, gelüstet es nach einer jungen Frau. Sein zur Schau getragener Reichtum soll helfen, noch mal so richtig durchzustarten – allerdings ohne nennenswert Geld auf den Tisch zu legen. Während sich Don Pasquale im Driverseat wähnt, sind ihm die junge Dame (Norina) und ihr ebenfalls noch nicht ergrauter Helfer und Liebhaber (Ernesto) immer einen Schritt voraus. Da kann auch der Leibarzt nicht helfen und es kommt, wie es kommen muss. Der Titelheld wird vorgeführt, steht ziemlich dumm, aber auch einsichtig da – jung und alt, das passt einfach nicht?
Gaetano Donizetti (1797 – 1848)
Don Pasquale
Text von Giovanni Domenico Ruffini und Gaetano Donizetti nach Angelo Anelli
In italienischer Sprache mit deutschen und englischen Übertexten
Uraufführung am 3. Januar 1843, Paris (Théâtre-Italien)
Chor und Orchester der Staatsoper Hamburg
Ramón Tebar – Musikalische Leitung
David Bösch – Inszenierung
Patrick Bannwart – Bühnenbild
Staatsoper Hamburg, 23. April 2024
von Jörn Schmidt und Regina König
Es könnte ja so einfach sein. Don Pasquale, ausstaffiert als alter reicher Sack, gelüstet es nach einer jungen Frau. Sein zur Schau getragener Reichtum soll helfen, noch mal so richtig durchzustarten – allerdings ohne nennenswert Geld auf den Tisch zu legen. Während sich Don Pasquale im Driverseat wähnt, sind ihm die junge Dame (Norina) und ihr ebenfalls noch nicht ergrauter Helfer und Liebhaber (Ernesto) immer einen Schritt voraus. Da kann auch der Leibarzt nicht helfen und es kommt, wie es kommen muss. Der Titelheld wird vorgeführt, steht ziemlich dumm, aber auch einsichtig da – jung und alt, das passt einfach nicht? „Auf den Punkt 2: Gaetano Donizetti (1797 – 1848), Don Pasquale, klassik-begeistert.de, 24. April 2024“ weiterlesen